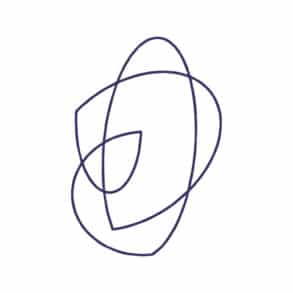«Liefern Sie die Steine, den Tempel baut der Zuschauer, die Zuschauerin!», sagt der Drehbuchautor und Filmemacher Wolf Otto Pfeiffer.
Mit ursprünglichen, alten Formen im Gehirn würden wir die Bilder, Einstellungen und Szenenwechsel dann zu einer Geschichte fügen. Deshalb, so Pfeiffer weiter, dürfe man die schöpferische Leistung des Zuschauenden, auch wenn sie mit basalen Gehirnfunktionen geleistet werde, nicht geringschätzen. Damit antwortet er auf das Argument von Medienkritikern, dass sich beim TV-Konsum im Gehirn die für das Traumbewusstsein verantwortlichen Alpha-Wellen feststellen lassen. Man träumt beim Filmkonsum – und dennoch: Zählt auf dem Gemälde das Nebeneinander der Formen und Farben, über die das Auge wandert und so ein Ganzes schafft, so ist es im Film der Schnitt der Szenen im Nacheinander. Damit aus diesen Steinen ein Tempel wird, so lehrt die Filmdramaturgie, muss jede Szene in sich eine Entwicklung haben, muss, wie es Aristoteles in seiner Poetik beschreibt, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende besitzen. Das klingt schlicht und ist doch so schwer. Im neuen Film über Anthroposophische Medizin beginnt es szenisch mit einer Orchesterprobe und endet mit Giovanni Maio, der Worte, Begriffe und Bilder sucht, um das Geheimnis des Organismus, des Zusammenspiels aus Hunderten Stimmen zu fassen – in der Mitte sind dann Ärztinnen und Pflegende, Pharmazeuten und Therapeutinnen unterwegs in der Sorge um dieses Konzert des Lebens.
Titelbild: Still aus dem Film ‹Die Kunst des Heilens›.