Oder: Wie werde ich gemeinschaftsfähig?
Der französische Philosoph Abdennour Bidar, selbst Muslim, schreibt nach den Attentaten von Paris im Jahr 2015 einen ‹Offenen Brief an die muslimische Welt›1 Darin richtet er einen aufrüttelnden Appell an den Islam: Der Mensch ist laut Koran der ‹Kalif› – also das individuelle Ebenbild – Gottes, nicht etwa der Sklave Gottes oder der Religion. Aber noch interessanter ist, wozu er ‹den Westen›, also uns, aufruft: «Im Menschen gibt es etwas Unendliches, das ihn […] zwischen Nichts und Alles stellt, ihn zum unsterblichen König des Universums macht und zu dem Staub, der zu Staub zurückkehren wird […]. Das Unendliche – man nennt es Gott oder Kosmos – ist das einzige Maß für die menschliche Maßlosigkeit.»2
Der westliche Mensch, so Bidar, habe viele Rechte erworben, aber das wertvollste aller Rechte eingebüßt: das Recht auf Unendlichkeit, das Recht, sich mit der der Menschheit innewohnenden Unendlichkeit in Verbindung zu setzen. Indem der westliche Mensch sich nur als Individuum entwickle, schaffe er ein ‹Ich ohne Wir›. Dabei sei es tatsächlich die Geschwisterlichkeit, die uns erschaffe: «Nur in einem System der Geschwisterlichkeit können wir wirklich als Menschen leben. Geschwisterlichkeit ist unser Ökosystem. Unser kleines Ich vertrocknet und stirbt, wenn es nicht mehr durch all die sichtbaren und unsichtbaren Interaktionen gespeist wird, die es an unser Gegenüber binden – das Gegenüber in sich selbst, das Gegenüber im anderen, das transzendentale Gegenüber, das wir Gottheit, Natur oder Weltenseele nennen.»3
Dieser Aufruf Bidars macht uns ‹Westler› auf einen notwendigen Perspektivenwechsel aufmerksam: Wir Menschen des 21. Jahrhunderts sind heute alle längst Individuum genug! Die Selbstverwirklichung haben wir in Europa schon 2000 Jahre lang geübt und praktiziert. Die alten Griechen und Römer revolutionierten das soziale Leben um die Zeitenwende, indem sie den individuellen Menschen vom Rechtsobjekt zum Rechtssubjekt machten. Vorher waren Menschen – mit Ausnahme der jeweiligen Herrscher und Priester – Gruppenwesen ohne eigene Rechte. In Athen und Rom bekamen sie nun individuelles Eigentum und Vertragsfreiheit – das war der Startschuss für die immer stärkere Individualisierung des Menschen und für die Leistungsgesellschaft, in der jeder nur für sich sorgt. Zuerst galt das Recht nur für eine relativ schmale Oberschicht. Sklaven und Plebejer waren noch ausgeschlossen. Heute gelten Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle. Wir sind alle Königinnen oder Könige geworden und beanspruchen alle Freiheiten und Rechte gleichzeitig. Was schlicht nicht geht, denn dafür sind wir einfach viel zu viele, und unsere Ressourcen sind nicht unerschöpflich.
Wie wir werden wollen
Wenn ich mich als Individualität entfalte, tangiere ich andere und schränke deren Freiheiten und Rechte ein. Wenn Regierungen während der Coronapandemie Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit der in der jeweiligen staatlichen Gemeinschaft lebenden Menschen ergreifen, fühlen sich viele schon dann in ihren persönlichen Freiheitsrechten eingeschränkt, wenn sie harmlose Pflichten wie Händewaschen, Abstandhalten oder Maskentragen einhalten sollen. Uns heutigen Menschen fehlt durch das jahrhundertelange Training der Individualität das Gefühl dafür, dass wir immer und notwendigerweise andere Menschen verletzen oder einschränken, wenn wir unsere eigene Persönlichkeit voll entfalten.
Uns heutigen Menschen fehlt durch das jahrhundertelange Training der Individualität das Gefühl dafür, dass wir immer und notwendigerweise andere Menschen verletzen oder einschränken, wenn wir unsere eigene Persönlichkeit voll entfalten.
Dabei bedarf es nur eines einfachen Perspektivenwechsels: Wenn ich meine Individualität entfalten möchte, kann ich – so ist die herkömmliche Perspektive – meinen Geist trainieren durch Wissenserwerb, Philosophie, Meditation und vieles andere mehr. Ferner kann ich meinen Körper fit halten durch Sport, durch Joggen, Walken und andere Aktivitäten. Oder – was schon seltener geschieht – ich arbeite an meinen Emotionen und Bedürfnissen. Oder ich betreibe Yoga oder begebe mich sogar auf den anthroposophischen Schulungsweg und trainiere Geist, Leib und Seele.
Aber alles, was sich da entfaltet, ist die Persönlichkeit, die ich morgens im Spiegel und während der zahlreichen Videokonferenzen in irgendeiner Ecke im kleinen Selbst-Bild sehe, die sich entsprechend meiner körperlichen Konstitution gut oder schlecht fühlt, die je nach meinen Erlebnissen Lust und Freude oder Schmerz und Trauer empfindet. Auf dieses Bild von unserer Individualität sind wir gewöhnlich fixiert und trachten danach, dieses Bild, also unser Image, immer besser, erfolgreicher, gesünder, fitter, klüger, aber auch aktiver, einfühlsamer, bescheidener und gütiger zu gestalten. Je besser sich dann das Image-Spiegelbild für mich anfühlt, desto zufriedener bin ich: ‹Liebe dich selbst – und es ist egal, wen du heiratest!›4
Der versteckte Egoismus
Das alles ist ja überhaupt nicht falsch, nur reicht es heute nicht mehr aus. Natürlich muss ich meine Persönlichkeit, so wie sie mir nun mal zur Verfügung steht und was ich daraus gemacht habe, akzeptieren und lieben – das ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt gemeinschaftsfähig werden kann. Aber dann gilt es, die Perspektive zu erweitern. Das beginnt mit der Frage: Warum ist es eigentlich wichtiger, dass es mir gut geht und dass ich Erfolg habe, als dass es meinem Partner gut geht, meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Freunden? Und dass mein Arbeitskollege Erfolg hat? Wer diese Frage abtut und behauptet, das sei ja gar nicht so, der belügt sich selbst. Das merken wir spätestens, wenn ein Freund oder Verwandter eine Krankheit bekommt, die wir nicht gern hätten. Wollen wir dann mit ihm tauschen? Sicher nicht: Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, sagen mir meine Gefühle und Gedanken: Gut, dass es mich nicht erwischt hat! Und wir planen, wie wir noch mehr für unsere Gesundheit vorsorgen können.
Nur in einem System der Geschwisterlichkeit können wir wirklich als Menschen leben. Geschwisterlichkeit ist unser Ökosystem.
Oder ein weniger schwerwiegendes Beispiel: Wenn ich in einer Konferenzrunde sitze und sich ein sehr kluger und weiterführender Gedanke in meinem Kopf entwickelt und just in diesem Moment sich eine Kollegin oder ein Kollege meldet und genau diesen Gedanken äußert, allerdings leider etwas ungelenk und lange nicht so gut, wie ich ihn vorgebracht hätte: Freuen wir uns dann mit dem oder der anderen darüber? Wieder nein, wenn ich mich nicht belüge: Die erste Reaktion in einer solchen Situation ist Ärger. Darüber, dass ich nicht selbst mit dem weiterführenden Gedanken glänzen durfte, und vielleicht auch darüber, dass die andere Person mit ihrer Darstellung dem wunderbaren Gedanken gar nicht richtig gerecht geworden ist. Ich selbst hätte das viel besser gemacht!
Ich selbst? Wer ist denn das eigentlich? Bin ich reduziert auf diesen Körper, den ich im Spiegel sehe, auf die psychische Entität, die ich als in diesem Körper wohnend empfinde? Oder ist das bei näherer Betrachtung ein ganz unvollständiges Bild?

Wenn ich das erst einmal zumindest für möglich halte, stellen sich ganz überraschende weitere Fragen: Warum hat denn der Kollege denselben Gedanken wie ich in fast derselben Sekunde gehabt? Warum berührt mich die Krankheit eines Freundes so tief, dass ich mitleide? Warum treffen mich Schicksalsschläge meiner Kinder oder meiner Partnerin wie mich selbst? Wo sind denn eigentlich meine Gefühle, meine Trauer oder meine Freude – in dem Menschen, den ich im Spiegel sehe oder bei den Menschen, mit denen ich mitleide oder mich mitfreue? Zu wie viel Prozent bestehe ich aus meinen Genen und aus dem, was ich erkannt, erfühlt und erarbeitet habe, und zu wie viel Prozent aus dem, was ich von anderen Menschen übernommen habe? Mit welchem Recht schließe ich meine Eltern, meine Lehrerinnen und Lehrer, aber auch alle diejenigen Menschen, von denen ich vielleicht nach einer einmaligen Begegnung eine entscheidende Fähigkeit adaptiert habe, von der Entität aus, die ich Individualität oder Ich nenne?
Der Perspektivenwechsel, der sich aus diesen Fragen ergibt, ist wie ein zweites Erwachen: Irgendwann – meist im dritten Lebensjahr – beginnt ein Kind, ich zu sich zu sagen und damit eine deutliche Grenze zwischen sich selbst und die anderen Menschen (z. B. Eltern) zu setzen. Diese von mir als Kind gesetzte Grenze bestimmt fortan meine Vorstellung davon, was meine Individualität nicht ist, nämlich alles auf der anderen Seite der Grenze: die anderen Menschen, die Tiere, die ganze Natur, die Erde, aber auch – je nachdem, woran ich glaube – Gott, der Teufel, die Engel. Und nun vollzieht sich der Perspektivenwechsel: Ich bemerke, dass diese von mir als Kind gesetzte und seitdem vorgestellte Grenze gar nicht wirklich existiert. In meinen Kindern lebt viel von meiner Individualität, was ich selbst nie ausgelebt habe oder ausleben konnte; in meiner Partnerin finde ich – wie der Volksmund sagt – meine ‹bessere Hälfte›: Lebenspartner ergänzen sich gegenseitig oft frappierend, besonders wenn sie lange zusammenleben. Dagegen spricht nicht, dass Partnerschaften auseinandergehen können: Selbst im gegenseitigen Hass verbindet Ehepaare oder sonstige Partnerschaften noch vieles. Was mir verloren geht, bemerke ich erst nach einer Trennung: ein Stück meines Ich geht mit dem Partner, beim Tod ebenso wie bei einer Scheidung.
In meinen Kindern lebt viel von meiner Individualität, was ich selbst nie ausgelebt habe oder ausleben konnte; in meiner Partnerin finde ich – wie der Volksmund sagt – meine ‹bessere Hälfte›.
Wie das Ich sich weitet
Und weiter: In dem Berufskollegen entdecke ich plötzlich auch – wie in einem Spiegel – mich selbst; sogar beim Zusammentreffen mit mir bisher unbekannten Menschen habe ich plötzlich Erkenntnisse über mich selbst, die ich sonst nicht gehabt hätte. Diese neue Perspektive ist nicht einmal nur auf Menschen beschränkt: Auch im Haushund oder in der Hauskatze kann ich mein eigenes Verhalten gespiegelt bekommen. Aber bleiben wir erst einmal beim Menschen.
Mit dieser neuen Perspektive kann ich mich ganz anders in soziale Gemeinschaften einbringen als vorher mit der vorgestellten Grenze zwischen meinem Ich und der Welt:
• In einer Partnerschaft entdecke ich dadurch das Anderssein des Partners oder der Partnerin und freue mich daran, weil es meine Einseitigkeit ergänzt. Vorher habe ich mich darüber geärgert, was der Partner nach meinen Maßstäben nicht richtig machte, jetzt freue ich mich darüber, täglich neue Anregungen zu bekommen.
• In einem Arbeitsteam oder einem Kollegium bemerke ich, dass alle Kolleginnen und Kollegen, und zwar unabhängig davon, ob ich sie mag oder nicht, mit mir zusammen eine Qualität bilden, die es mir erst wirklich ermöglicht, mich in meiner Arbeitstätigkeit zu entfalten und weiterzuentwickeln. Jede Kollegin und jeder Kollege ergänzt mich. Und das ermöglicht es mir, dankbar dafür zu sein, wenn jemand aus der Gemeinschaft eine andere Meinung vertritt als ich oder eine Aufgabe anders angeht, als ich das tun würde. Denn dadurch sehe ich Teile der Wirklichkeit, die ich sonst nie gesehen hätte.
• Wenn ich diese Perspektive erst einmal im privaten Bereich geübt und dadurch mein erweitertes Ich kennengelernt habe, kann ich sie auch erweitern auf Kundinnen (bei Lehrkräften: auf Schüler und Eltern), auf Nachbarinnen, auf die Bewohner meiner Stadt, auf Flüchtlinge, auf die Natur, auf meinen Planeten Erde.
Den Perspektivenwechsel kann ich üben. Einige Beispiele:
• Ich kann trainieren, meine Gefühle und die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen und – was noch wichtiger ist – sie mir bewusst zu machen. Das verschafft mir mehr und mehr die Möglichkeit, von mir und von den anderen mehr als die Außenseite (den Spiegel) wahrzunehmen.
• Ich kann Rückblicke üben – täglich, jährlich, nach Abschnitten meines Lebens. Das macht mir deutlich, wie der oder die andere schicksalsmäßig mit mir verbunden ist.
• Ich kann üben, Urteile, die sich bei Begegnungen und Erlebnissen einstellen, zurückzuhalten und zunächst zu versuchen, nur wahrzunehmen, was und wer mir begegnet. Das befreit mich aus dem ‹Tunnel› meiner Urteilsperspektive.
• Ich kann andere wertschätzen. Das öffnet die Herzen der anderen Menschen für das, was ich vorhabe, und befähigt sie, selbst Initiative und Verantwortung zu entfalten.
In seiner Bibel von 1545 übersetzt Martin Luther sowohl im Römerbrief als auch in der Geschichte vom barmherzigen Samariter die bekannte Aufforderung zur Nächstenliebe so: «Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst.» In allen späteren Übersetzungen findet sich die harmlosere Form: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» Das ist ein entscheidender Unterschied.
Wenn ich einen anderen Menschen liebe wie mich selbst, bleibt das abstrakt: Ja, ich gestehe ihm zu, dass er gleiche Rechte hat wie ich und dass er mit mir auf Augenhöhe ist. Aber der andere ist und bleibt jenseits der Grenze meines Ich, und ich bin innerhalb des Sperrbezirks meiner Individualität. Wenn ich den anderen Menschen dagegen liebe als mich selbst, dann ist er innerhalb dieses Bereichs meines Ich. Dadurch bekommt die Gemeinschaft – genauer gesagt: jede und jeder Einzelne aus der Gemeinschaft – eine ganz andere Wertigkeit als zuvor. Wir sind nicht mehr Könige oder Königinnen, die gegenüber allen anderen eine unbeschränkte Freiheit für sich beanspruchen, sondern wir lernen, ‹Königskinder›5 zu sein, die trotz aller Katastrophen in Natur und Gesellschaft nicht ertrinken, wenn wir zueinander kommen wollen. Wir lernen, jeder von uns, den anderen als Teil des eigenen Ich zu lieben und wertzuschätzen. Das macht uns gemeinschaftsfähig. Und das wiederum ist ‹ansteckend› – eine wirklich positive Variante von Infektionsketten!
Footnotes
- Abdennour Bidar, Offener Brief an die muslimische Welt, Hamburg 2019
- Ebd., S. 45.
- Ebd., S. 47.
- Ein wunderbarer Buchtitel der Autorin und Beziehungsberaterin Eva-Maria Zurhorst. Das Buch ist auch nicht schlecht, aber eigentlich sagt der Titel über den Inhalt schon alles Wesentliche.
- Diesen Ausdruck übernehme ich von Gerald Häfner aus seinem Beitrag ‹Wir armen Königskinder›

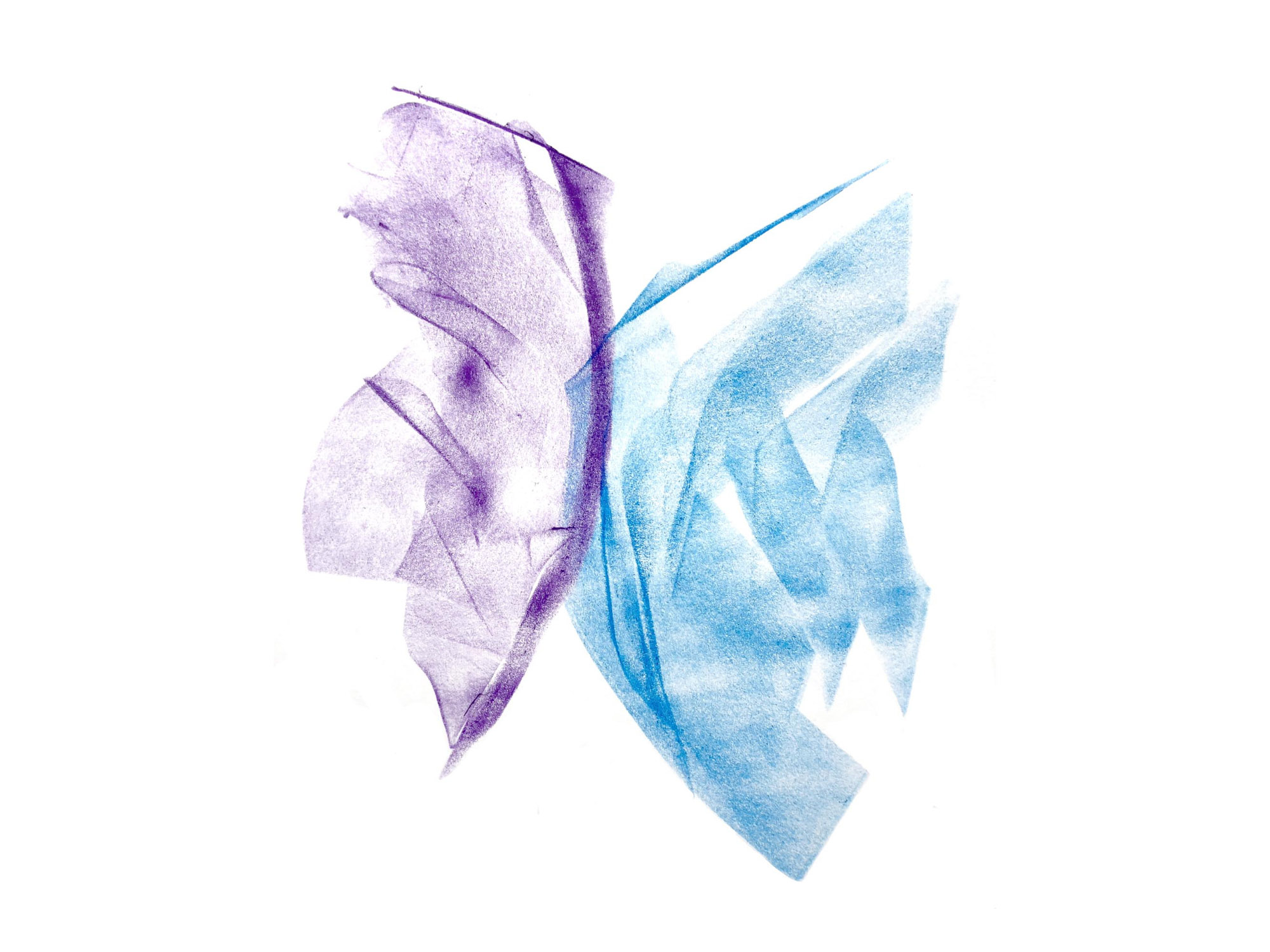












Dieser Text, der so bescheiden daher kommt wie Sie selbst, lieber Herr Krampen, scheint mir wesentliche Elemente in sich zu bergen, die diese Zeitenwende benötigt. Von meiner Seite allerherzlichsten Dank.