Die Worte sind stumm geworden und wir sind auf dem Weg zu einer neuen Sprache, wo nicht mehr die Worte sprechen, sondern wir selbst es sind, die sprechen. Tun wir doch, wird man sagen. Nein, ich glaube nicht. Wir fangen erst an, sprechen zu lernen.
«Die Worte haben ihre Aura verloren.» Das sagte mein Freund Joachim Daniel an einer Tagung am Goetheanum vor vielleicht 15 Jahren. Die deutschsprachigen Schreibenden hatten es schon vor 70 Jahren gefühlt, ließen in Gedichten die Sprache versiegen, als Winston Churchills Satz wahr wurde, dass das erste Opfer des Krieges die Wahrheit und damit auch ihr Vehikel, die Sprache sei. Die Dichterinnen und Dichter verstummten. Die deutsche Sprache traf es hart. Der britische Komiker John Cleese sagte im Interview in der FAZ am 26. Mai 2006, dass viele Engländerinnen und Engländer von all den Filmen über den Zweiten Weltkrieg denken, dass man deutsch nicht spreche, sondern belle. Das gebellte ‹Jawoll› wurde zur gesamteuropäischen Erfahrung. Wichtig dabei: ‹deutsch› meint zu allererst die Sprache, nicht die Landschaft, nicht die Menschen. Das Adjektiv taucht Ende des 8. Jahrhunderts in den Strassburger Eidformeln auf als ‹teudisca lingua›, als Name für die germanische Volkssprache im Gegensatz zur lateinischen. Die Tragödie des 20. Jahrhunderts hat die deutsche Sprache und die, die sie sprechen, traumatisiert, das sagen Sprachwissenschaftler wie Jürgen Trabant.1 Welch ein Glück, als 2011 Thea Dorn und Richard Wagner den Mut fassten, auf die Spurensuche zu gehen, wo ‹deutsch› weltweit lebt und nicht als fremdes Gebell genommen, sondern zum Eigenen erklärt und eher geflüstert oder gesungen wird. Sie sammelten in dem Buch ‹Die deutsche Seele› Worte von ‹Abendbrot› bis ‹Zerrissenheit›, von ‹Ordnungsliebe› bis ‹Feierabend›, die in Sprachleibern der USA oder Russlands leben. Solche sprachlichen Edelsteine erinnern an eine Zeit, als die Worte noch Aura besaßen und man sich deshalb manche Namen nicht auszusprechen getraute. «Unsere Philosophie der Toilettenreinigung» las ich kürzlich an einer Autobahnraststätte oder auf einer Internetseite mit Kochrezepten: «Das Mysterium der Nudeln». So ist das, jedes Wort kann heute überall erscheinen. Die Worte sind frei oder melancholisch formuliert: Sie haben ihren Umkreis verloren, sie sind, wie wir selbst, heimatlos geworden. Ich vermute, der reiche Gebrauch großer Worte – auch in der Anthroposophie – hat dazu beigetragen, dass die Worte so entwurzelt wurden, dass nichts oder kaum etwas klingt, wenn man Wendungen wie ‹Neue Mysterien› oder ‹Menschheitsrätsel› anschlägt. Rudolf Steiner hat einen Hymnus auf das Stummwerden der Sterne geschrieben: ‹Sterne sprachen einst zum Menschen›. Der Achtzeiler verspricht, dass es diese «stumme Stille» sei, in der in uns eine neue Sprache reife, die die Sterne hören könnten.2
Die Worte verstummen
Jetzt sind nicht nur die Sterne und mit ihnen die Natur verstummt, sondern auch die Worte selbst. Sie hören auf, zu sprechen. Könnte es sein, dass das der Moment ist, wo wir tatsächlich anfangen, ‹selbst› zu sprechen? Könnte es der Moment sein, wo wir nicht mehr darauf vertrauen können, dass ihre Glut und der Glanz der eigenen Rede Wärme und Licht, Liebe und Weisheit verleihen? Ob Jesus, Mohammed oder Buddha, all diese Väter des Glaubens gingen in die Wüste und haben in dieser Leere die Fülle gefunden und gebracht. Ist es mit der Sprache ebenso? Jetzt, wo die Worte nur noch sie selbst sind, da ist es an uns, sie so zu wählen und zu fügen, dass es aus den Worten zu sprechen beginnt. Mein Vater war Germanist und ist in viele meiner Artikel mit dem roten Stift gegangen, wo ein ‹bedeutend› oder ein ‹zutiefst›, wo Adjektive und Superlative einem Gedanken Farbe und Größe verleihen sollten. Er markierte damit, wo deshalb nicht ich sprach, sondern ich mich dieser alten Helfer bediente, um ein Wortgefüge zu beseelen. So wie Zucker nur für kurze Zeit den Hunger stillt, so ist es mit den Adjektiven, diesen sprachlichen Geschmacksverstärkern, sie versüßen, lassen aber nichts wachsen.
So gehört zum Zauber unserer Zeit, dass Tod und neues Leben gleichzeitig um uns sind. Da zeigt kein Wort mehr zum Himmel, kein Satz vermag von sich aus Ehrfurcht in die Glieder zu jagen und zugleich gilt für jede, die spricht, jeden, der spricht und jeden Augenblick, dass in einem Wort und durch ein Wort neues Leben sich entfaltet, neu auf etwas zeigen kann, berühren kann, wenn, ja wenn man selbst anfängt, zu sprechen. Das klingt so einfach und ist so schwer, denn es heißt, das Innere, das Behütete herauszukehren, heißt die Schalen abzulegen und verletzlich werden zu wollen, heißt, das, was man von sich nicht kennt, zeigen zu wollen. Es heißt, alle Menschen als ‹du› zu meinen, heißt zu vertrauen, dass die oder der Zuhörende tatsächlich zuhört. Die Umwälzungen zu einer digitalen Gesellschaft vergleichen wir gerne mit der Neolithischen Revolution, als vor 7000 bis 5000 Jahren alles anders wurde. Der Weg in die Stadt, der Weg in die Schrift ließ uns damals doppelt fremd werden. Wenn wir jetzt unsere eigene Sprache finden, indem wir stammeln und neu das richtige Wort suchen, den guten Satz bauen, kommen wir aus dieser Fremde wieder zu uns. Was Rudolf Steiner im antiken Griechenland las: «Mensch, rede, und du offenbarst durch dich das Weltenwort»3, das lautet heute vermutlich anders. Heute offenbaren wir uns selbst in der Sprache, und wo das gelingt, werden wir zum Okular, zum Schlüssel für alle anderen, durch uns die Welt und uns selbst zu verstehen. Es überrascht mich nicht, dass Goethe in seinem ‹Faust› diesen Moment, wo die Sprache des einen die andere verzaubert, als die Mitte dieses größten deutschen Sprachwerks erklärt. Helena hört Faust sprechen und nennt es ein «Wunder» und will diese Sprache, die ihr seltsam und freundlich klingt, lernen. Jede und jeder wird zum Sprachschöpfer, zur Sprachschöpferin, wenn da diese helenischen Ohren sind, die zu jedem der Worte hingehen wollen, jedes der Worte mit Liebe nehmen. So wird die neue Sprache zum Ort eines neuen Miteinanders.
Titelbild: Amador Loureiro/Unsplash
Footnotes
- Jürgen Trabant, Was ist Sprache. München 2008, S. 207.
- Rudolf Steiner, ‹Sterne sprachen einst zum Menschen›. In: Rudolf Steiner, Wahrspruchworte. Basel 1919. Siehe dazu Wolfgang Held: ‹Das Gespräch mit dem Kosmos›. In: Was ist Anthroposophie? Stuttgart 2017.
- Vortrag vom 2.12.1923 in Rudolf Steiner, Mysteriengestaltungen. GA 232, Dornach 1958.












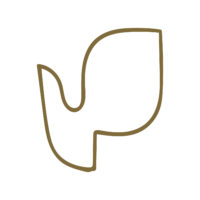

Danke Wolfgang.
Michael Braun