Die Schönheit rettet die Welt! Das verspricht der Narr in Fjodor Dostojewskis Roman ‹Der Idiot›, und die Narren sagen die Wahrheit, jene Wahrheit, die sich niemand traut zu sagen, weil sie so einfach ist. Doch wie lässt sich die Retterin der Welt, wie lässt sich das Schöne begreifen?
Mit einem Freund bin ich an der Birs, einem kleinen Fluss am Rheinknie, gewandert. Wir waren ins Gespräch vertieft. Es war mittags, die Sonne glänzte von Süden in den Bachlauf. Ich sah oft vorbei an dem so angeleuchteten Haarschopf meines Begleiters, vorbei auf den glitzernden Wasserlauf. Alles strahlte in Licht und Frieden, es war bezaubernd schön, eine Idylle. Ein Gegenbild aus meiner Jugend: 12. Klasse. Eine Exkursion nach Berlin führt uns in den Ostteil der Stadt, die damalige Hauptstadt der DDR. Beim Grenzübertritt lenken uns schmale Korridore vor die Augen der Grenzposten. Ich werde den leeren Blick, die seelenlose Sprache des Zöllners nicht vergessen. In schlecht sitzender Uniform schaut er in den Pass, dann auf mich und zurück zum Pass und wieder zu mir. Als hätte er geübt, hässlich zu schauen, geübt, mich und mein Bild im Pass zu strafen. Ein Stempel knallt und wortlos winkt er mich fort. Das Schöne und das Böse, das sind Gegensätze. Das ist rätselhaft, weil das Böse sich des Schönen allzu gern bemächtigt. Dann haben wir etwas Schönes vor uns und erst im zweiten, dritten Blick bemerken wir, dass darin oder dahinter etwas gar nicht Schönes lauert. Dieser Widerspruch gibt hier den Anfangston.

Zwei Ratschlägen bin ich auf diesem Weg, das Schöne zu verstehen, gefolgt. Der eine stammt von Joachim Daniel: Wenn du eine Frage vor dir hast, die größer ist als dein Vermögen, Antworten zu finden, so nähere dich in einer Spirale dem Kern, umkreise, umzingle, was du verstehen willst, so prallst du nicht ab und verlierst die Frage nicht aus dem Auge. Den zweiten Rat gab Ernst Wilhelm Barkhoff, Pionier anthroposophischen Bankwesens. Im Kreis von Jugendlichen sagte er: Wenn du etwas nicht verstehst und du möchtest es dennoch fassen, so vereinbare einen Vortragstermin über das Thema. Als die Weleda Schönheit und Gesundheit als gleichrangige Unternehmensziele formulierte, bot ich an, zum Verständnis von Schönheit etwas beizutragen. Daraus entwickelten sich Werkstatt-Vorträge in der internen Fortbildung und das Ergebnis ist hier zu lesen. In sieben Wendungen will ich mich dem Schönen nähern.

Das Schöne ist nicht nötig
Es beginnt mit der philosophischen Werkstatt von François Cheng. Der chinesisch-französische Philosoph hat über die Schönheit fünf Meditationen geschrieben.1 In der ersten fragt er, ob man sich eine Schöpfung vorstellen könne, in der eine der drei christlichen Tugenden nicht existiere. Wie wäre eine Welt, wenn darin Güte, Schönheit oder Wahrheit nicht vorkäme? Ich hätte diesen Text nicht geschrieben, wenn ich nicht damit rechnen dürfte, dass er wohlwollend aufgenommen wird. Ohne die Güte unserer Eltern, unserer Lehrerinnen und Lehrer wären wir nicht da. Eine Welt ohne Güte, ein Kosmos ohne Liebe ist nicht denkbar. Es braucht nicht viel, das zu verstehen. Ähnlich ist es mit der Wahrheit. Ein Kosmos, in dem es nichts Wahres gibt, nichts Gültigkeit besitzt, sondern alles Täuschung, Fake News wäre, macht es unmöglich, zu leben. Auf nichts könnte man sich verlassen, nichts würde tragen. Eine Autorin wär keine Autorin und ein Leser kein Leser. So hält Cheng fest: Ein Leben, ein Sein ohne Güte, ohne Wahrheit gibt es nicht. Aber ein Sein ohne Schönheit ist denkbar! Eine vollständig hässliche Welt lässt sich denken, und es gibt genug Geschichten, die sich vollkommene Hässlichkeit ausmalen. Manche Landstriche Osteuropas, so berichten Reisende, hätten zur Zeit des Kalten Krieges sich diesem Szenario solcher Trostlosigkeit angenähert und Bilder des zerbombten Mariupol sind dem auch nicht fern. Das unterscheidet Schönheit von Wahrheit und Güte, dass eine Schöpfung ohne das Schöne möglich wäre. «Das Universum ist nicht auf Schönheit angewiesen», schließt Cheng. Und doch ist das Universum unendlich schön, von einer Blumenwiese, einem Kinderlachen zu einem Sommerregen. Das ist die Größe der Schönheit, dass sie ist, obwohl sie es nicht sein müsste. Sie ist ein Geschenk, das so selbstverständlich über uns kommt, dass wir uns gar nicht eine Welt vorstellen können ohne Schönheit. Weil die Welt schön ist, ohne schön sein zu müssen, muss sie schön sein wollen, muss diese Welt sich frei entschlossen haben, schön zu sein!

Blattadern: Wenn das
Leben weicht, sieht man,
dass Schönheit es trägt.
Bild: Nina Gautier.
Das Schöne ist einmalig und ewig
Zurück zur Birs: Wie das Licht auf das Wasser fiel, es die Wellen glitzern und Wanderer und Spaziergängerinnen blinzeln ließ, genau so wird es niemals mehr sein. Ein Augenblick, der geht und nicht wieder kommt. Das Schöne ist einmalig. Das ist das Tragische, das zum Schönen gehört: seine Einmaligkeit! So heiligt das Schöne den Augenblick. Wer einmal Klatschmohn gepflückt hat, kennt den Schmerz. Wie schnell die Schönheit geht! Und doch: So einmalig dies Wasser-Sonnen-Spiel war, der Anblick wird nicht der Einzige bleiben. Es wird eine neue, eine andere, vielleicht noch berührendere Schönheit geben. Das ist das Versprechen des Schönen, dass bei aller Einmaligkeit es doch ein nächstes Mal gibt und geben muss. Der schöne Moment macht einem späteren schönen Augenblick Platz. Jede Blüte verblüht und verspricht im Welken, dass es weitere Blüten, weiteres Blühen gibt. Es wäre ganz unsinnig, wenn es nur diesen einen schönen Moment gäbe, wenn es mit ihm vorbei wäre und kein weiterer folgen würde. Dann wäre er sinnlos und verloren. So ist das Schöne einmalig – was Schiller in die Worte fasst: «Auch das Schöne muss sterben. Es weinen die Götter, wenn das Schöne vergeht» – und es ist ewig. Im Schönen liegt Augenblick und Ewigkeit.

Das Schöne klingt und drängt
Weil der Einmaligkeit des Schönen eine nächste Einmaligkeit folgt, gehört zum Schönen viel mehr als seine eigene Wiederkehr, es ist das Versprechen, dass auch unserer persönlichen Einmaligkeit eine weitere folgt.Das Schöne verspricht, wie es einfacher nicht sein könnte, Unsterblichkeit. Nun schreibt der Philosoph Byul chul Han, dass wir selten sagen würden, dass etwas schön ‹sei›, sondern vielmehr: «Das war schön!» Um das Schöne zu erfassen, müsse man Innehalten, um den «fluoreszierenden Nachklang» des Schönen zu fassen. Den Moment des Schönen erfahren wir, so beobachtet er, in dessen Echo in der Seele. Das Schöne heiligt den Augenblick, erschöpft sich aber nicht im Jetzt, ist nicht darin gefangen, sondern im Nachsinnen. Im seelischen Wiederkäuen blüht das Schöne erst auf. Deshalb verträgt sich der schnelle Wandel der Zeit nicht gut mit der Erfahrung des Schönen.

Das Schöne ragt als seelisches Echo nun nicht nur in die Zukunft, es hat interessanterweise auch seinen Vorlauf, seine Wurzeln im Davor. Das erzählt jede Rosenknospe! Da kommen wir näher an den Kern des Schönen. Die Rose ist schön. Gleichzeitig spüren wir im Schönen den Willen, schön zu sein, schön zu werden. Das umgibt die Knospe wie eine Aura: «Ich werde blühen!» Das ist der Drang zum Schönen! Welch ein Widerspruch: Das Schöne kennt keine Absicht und drängt doch zum Schönen! Da ist ein geheimer Wille zu spüren und diesen Willen teilen wir Menschen mit der ganzen Schöpfung: Wir wollen selbstbewusst sein, wir wollen klug wirken, aber tief in der Seele wollen wir vor allem dieses: schön sein! François Cheng sagt es so: Wir wollen mit dem Glanz und der Glorie des Universums in Verbindung sein. Wenn so im Schönen der Drang zum Schönen lebt, dann ist die Schönheit nicht nur Bild, dann ist sie eine Kraft! Dazu folgende Begebenheit:
Vor ein paar Jahren habe ich eine Lesung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel besucht. Er erzählte von seiner Gefangenschaft, weitgehend in Einzelhaft. Das türkische Gefängnis sei eine Symphonie aus Metall und Gestank und Stahl gewesen. Am Schluss kreiste ein Mikrofon, ich griff zu und fragte, wie er die Einzelhaft überstanden habe. Er wollte gewohnt politisch antworten, besann sich aber dann: «Da erzähle ich was anderes. Ich habe mir einen Joghurtbecher genommen und ihn versteckt. Aus zerbröselten Eierschalen und dem Inhalt von Teebeuteln habe ich ein Substrat hergestellt. Wir bekamen Gewürze für das Essen, so nahm ich ein Minze-Pflänzchen und habe es in meiner künstlichen Erde angepflanzt und vor den Wärtern im Kühlschrank versteckt.» Diese Minze-Pflanze, die erst so krumm hing und sich dann aufrichtete, die Schönheit dieser kleinen Pflanze, so sagte er, habe ihn gerettet. In der Ödnis des Gefängnisses stand diese Minze, die Schönheit des Werdenden ihm bei. Mehr als die Minze und ihre Schönheit war es diese Kraft, dieser Hymnus des Schönen, die ihn bewahrten.

Das Schöne ist verborgen
«Die Natur liebt es, sich zu verbergen», schreibt Heraklit.2 Ja, oft versteckt oder tarnt sich das Schöne, übersieht es der erste Blick. Das habe ich in einem Seminar mit dem Künstler Alexander Schaumann verstanden. Er hat vor vielleicht 15 Jahren begonnen, Seminare in Menschenbetrachtung3 anzubieten. Man sitzt im Kreis und schaut gemeinsam auf eine Person, deren Gestalt oder vielleicht nur auf die Augen. Wir hatten eine koreanische Eurythmiestudentin vor uns. Gemeinsam charakterisierten wir, was wir sahen, und mit jedem Votum nahm im Raum die Aufmerksamkeit zu, wuchsen in der Gruppe Organe des Schauens, Einfühlens und Verstehens. Von Minute zu Minute stieg unsere Beobachtungsfähigkeit, wurde die Studentin schöner und schöner. Den eigentlichen Zauber dieser Stunde begriff ich, als ich beim anschließenden Essen neben der Eurythmistin saß: Ihre Anmut, die sichtbar-unsichtbaren Ströme um ihren Körper, das Licht um Auge und Stirn, ihr Zauber schien verflogen. Hatten wir uns getäuscht? Als wäre sie ein anderer Mensch. Also gibt es eine Schönheit, die ist auf gesteigerte Aufmerksamkeit angewiesen. Ich vermute, das gilt vor allem für das menschliche Antlitz. Da ist dieses Geheimnis am stärksten, da ist das so Einmalige so alltäglich. Vielleicht ist das das ‹Romantisieren›, von dem Novalis spricht, wenn er uns zuruft: «Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder.» Das Wort Sinn wird uns noch einmal beschäftigen. Weiter schreibt er: «Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimes Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisierte ich.» Dem Bekannten die Würde des Unbekannten zu verleihen, bedeutet, mit neuen Augen, mit einer Frage auf alle und alles zu schauen. Und in seinen Fragmenten schreibt er, der Maler müsse «die Welt schön sehen», vollenden, vollkommen machen. Das ist ja die menschliche Fähigkeit, dass wir am Makel vorbei die Schönheit ans Licht bringen. Dass wir etwas schön sehen können, vollkommener sehen können.
Der Soziologe Georg Simmel sagt über das menschliche Antlitz, dass es zur Neuzeit gehöre, dass wir viele Menschen sehen, aber sie nicht sprechen hören. Wir sehen auf der Straße, hundert Gesichter, vernehmen aber nicht die Stimmen dazu. Manchmal sitze ich im Zug jemandem gegenüber und denke: «Was für ein interessantes Gesicht, aber ich verstehe es nicht!» Simmel sagt, das ist fast immer so, weil ein Gesicht so reich ist, weil die ganze Biografie darin ist, dass wir es nicht verstehen. Sobald die- oder derjenige anfängt zu sprechen, wird es verständlich. Deshalb frage ich dann: «Wie heißt die nächste Haltestelle?» Um so das Gesicht ‹zu hören›.

Das Schöne macht schön
Dass der Anblick des Schönen den Betrachtenden verwandelt, das habe ich am anderen Ende der Welt erfahren. Eine Sonnenfinsternis führte mich mit zwölf Interessierten auf die Osterinsel im Südpazifik. Mit dabei war ein Ehepaar aus München, Franz und Elisabeth Wiegand, die für die teure Reise gespart hatten. Als nun an diesem einsamsten Ort der Erde umgeben von den stummen Steinfiguren, den Moais, der Mond die Sonne bedeckte und so den geheimnisvollen Strahlenkranz vor dem anthrazitfarbenen Mond sichtbar werden ließ, da schaute ich hinüber zu ihr, zu Elisabeth Wiegand. Mit offenem stillem Blick schaute sie empor. Rührung, Ergriffenheit und Andacht in ihren nassen Augen verzauberten ihre Züge, ihre ganze Gestalt. Ich konnte mich nicht entscheiden, was schöner ist, das Himmelsschauspiel da oben, für das wir 20 000 Kilometer gereist sind, oder das Antlitz von Elisabeth Wiegand. Im Anblick des Schönen werden wir schöner. Das Schöne stiftet an. Schön macht schön. Deshalb sind Waldorfschulen schön, weil sie die Schülerinnen und Schüler schöner werden lassen. Die frühere Widar-Klinik in Järna: so breite Holzdielen, was für eine schöne Klinik! Ja, Schönheit steckt an, ist pandemisch. Deshalb: Wer sich kleidet, wer vor dem Spiegel sich Zeit nimmt, tut viel mehr, als sich selbst herauszustellen, er oder sie macht die Umgebung schöner, macht all jene, die es sehen schöner.
Das Schöne ist gut
Es geschieht auch, dass der Schein trügt, das Schöne betrügt. Davon war am Anfang die Rede. Weil die Schönheit so anzieht, weil die Sehnsucht danach groß ist, liegt es nahe, mit dem Schönen Geschäft zu machen. Da wird es zum Arrangement. Drang und Nachklang und den Betrachter oder die Betrachterin verschönern, das gibt es da nicht. Wie erkennen wir die Täuschung? Wie erkennen wir den Unterschied vom Arragement zum ursprünglich Schönen? Dazu gibt der französische Philosoph Henri Bergson einen Schlüssel: «So wird derjenige, der mit dem Auge des Künstlers das Universum betrachtet, durch die Schönheit die Anmut des Universums erfahren und durch die Anmut wieder die Güte durchleuchten sehen.»4 Was für ein Dreischritt! Zuerst müsse man mit den Augen einer Künstlerin, eines Künstlers auf das Schöne blicken. Es kommt auf diese Augen an, um zu prüfen, ob es Arrangement ist, gefällig ist oder wirklich schön. Unter solchen Augen zeige sich, so Bergson, die Anmut im Schönen, also die Demut, Selbstverständlichkeit und Grazie. Und geborgen und verborgen in diesem glimmt nun die Güte, die Liebe. Aus der Schönheit wird die Anmut und aus der Anmut die Güte. Fühle ich beim Anblick des Schönen, dass darin Anmut spricht und die Güte zu Hause ist? Das Schöne ist absichtslos – «Die Rose ist ohne Warum / Sie blüht, weil sie blüht. / Sie achtet nicht ihrer selbst. / Fragt nicht, ob man sie sieht», schreibt Angelus Silesius. Ja, die Absicht nimmt dem Schönen seine Anmut und doch drängt es zu erscheinen. Es führt, wie François Cheng schreibt, in den «Morgen des Universums». Wenn das Schöne «führt», dann hat es eine Richtung. Das lenkt den Blick zum Wort ‹Sinn›, das im Deutschen wie im Englischen drei Ebenen hat: Man kann das Schöne anschauen, es ist sinnlich. Es hat Bedeutung und damit ‹Sinn›, es ist deshalb sinnlich und sinnvoll. Und schließlich hat es in sich eine Richtung, einen Sinn, der über die eigene Persönlichkeit hinausführt.5

Das Schöne ist göttlich
Wohl niemand, der oder die über das Schöne spricht, kommt an Platon vorbei. Wie so oft ist es auch bei der Frage nach der Schönheit so, dass zu Beginn das Wichtigste gesagt ist. In Platons ‹Symposion›, da spricht Diotima, die blinde Seherin, über das Schöne. Es ist das einzige Mal, dass Platon eine Frau in die Mitte des Gesprächs stellt und wie bei allen platonischen Dialogen ist der Einstieg ins Thema zugleich dessen Boden. Auf die ersten Sätze von Diotima antwortet Sokrates, dass er hellsichtig sein müsse, um ihre Ausführung zu verstehen. Selbst Sokrates, der Klügste von allen, ist hier überfordert und kann ihr nicht folgen. Dann setzt Diotima fort: «So will ich es dir denn deutlicher sagen. Alle Menschen nämlich, o Sokrates, sprach sie, sind fruchtbar sowohl dem Leibe als der Seele nach, und wenn sie zu einem gewissen Alter gelangt sind, so strebt unsere Natur zu erzeugen.» Zum Menschen gehöre es, ab einem gewissen Alter Geistiges hervorzubringen. Martin Buber nennt es den Urhebertrieb im Menschen, die Sehnsucht, etwas hervorzubringen.6 «Erzeugen aber kann sie in dem Hässlichen nicht, sondern nur in dem Schönen.» Tatsächlich wird in einem Klima von Missgunst, Zorn oder Hass niemand etwas zu schöpfen vermögen. Die Seele wächst über sich hinaus, sie ist fähig, zu zeugen und zu gebären, wenn sie sich verbindet. Und sie verbindet sich mit dem Höheren, dem Schönen, nicht mit dem Hässlichen. Das Hässliche führt sie auf sich zurück.
So spricht auch Diotima: «Eine einführende und geburtshelfende Göttin also ist die Schönheit für die Erzeugung. Denn die Liebe, o Sokrates, geht gar nicht auf das Schöne, wie du meinst. – Sondern worauf denn? – Auf die Erzeugung und Geburt im Schönen.» Wir lieben nicht das Schöne, sondern wir lieben, was im Anblick des Schönen entsteht, Wille und Sehnsucht, selbst Schönes, Ewiges hervorzubringen. Damit haben wir einen Dreischritt, den das Schöne hervorbringt. Das Schöne entfaltet im Betrachtenden dessen Schönheit, es weckt in ihm oder ihr die Liebe, die Güte, weil im Schönen das Gute geborgen ist, und es treibt ihn oder sie an, auch Schönes hervorzubringen. Und weil dieses Schöne Anteil am Ewigen hat, verbindet sich damit die Seele mit dem Ewigen, dem Unsterblichen.
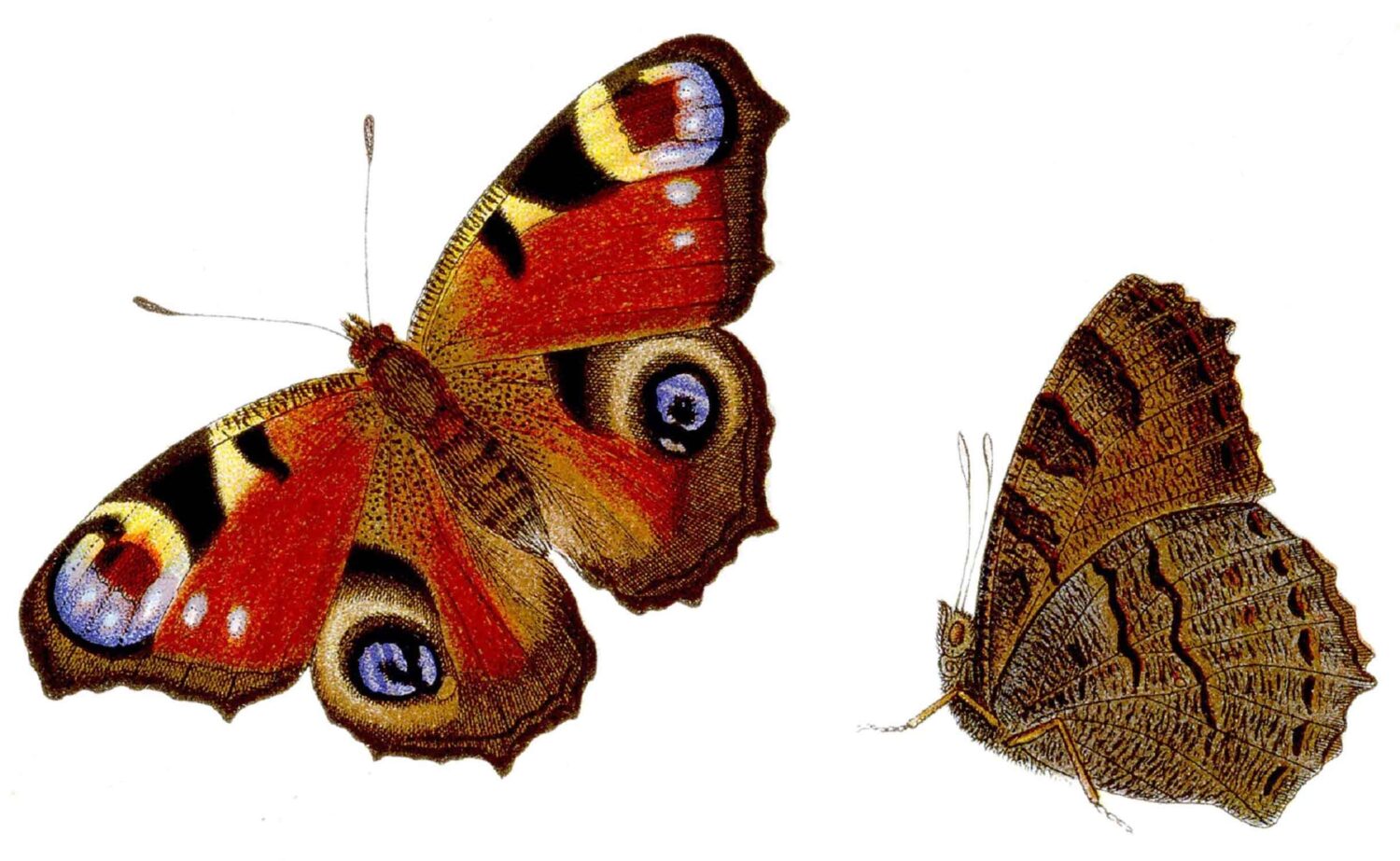
Wir Menschen werden göttlich
Wer im Gespräch sein Gegenüber inspirieren will, wird dessen Bilder, Gefühle und Vorstellungen aufgreifen, ja wird sie zum Rohstoff dessen machen, was man zu geben hat. Aus dem geistigen Leben des anderen, das man wahrzunehmen vermag, wächst so Neues. Nicht anders ist es wohl, wenn Engel und höhere Wesen uns Menschen inspirieren, wenn sie mit und aus uns Neues schaffen. Dann bauen sie aus unseren Gefühlen und Gedanken. Der vielzitierte Satz: «Die Gedanken von heute sind die Wirklichkeit von morgen» hat seine spirituelle Dimension. In dem Film ‹Der Himmel über Berlin› bringt Wim Wenders es ins Bild.7 Eine Kamera fährt durch eine Bibliothek, eine gewaltige Bücherlandschaft, und ein vielstimmiges Flüstern lässt die Gedanken all der Lesenden hören. Über die so Vertieften beugen sich Engel und nehmen ungesehen Anteil, ja sie baden sich in dem Geist, den all die Studierenden aus den Büchern zu neuem Leben wecken. Manche Kinder, die in der Bücherwelt an ihrem Schulreferat arbeiten, nicken den Engeln zu, als wären sie miteinander vertraut. Die Szene verrät, dass man ‹für› die Engel liest und denkt. Zur Schulung in der Anthroposophie gehört, dass aus dieser Gemeinschaft von denkend-fühlenden Menschen und wahrnehmenden Geistern sich Zukunft bildet. Höhere Wesen nehmen unsere Gedanken und formen daraus. Menschliche Ideen und Empfindungen werden zum Rohstoff einer neuen Welt. Wo wir das Schöne erfahren, da leisten wir diese Schöpfung selbst, da sind wir es, die – wie Platon es zeichnet – im Anblick des Schönen gebären und zeugen. Wo wir das Schöne erfahren, werden wir selbst schöner, weckt es die Liebe in uns und befeuert uns, so an einer neuen Welt zu bauen. Im Anblick des Schönen kommt die Schöpferin, kommt der Schöpfer in uns hervor, sind wir es, die die Welt retten.
Footnotes
- François Cheng, Fünf Meditationen über die Schönheit. München 2013.
- Heraklit, Fragmente. B 123.
- Wolfgang Held, Goetheanum Nr. 44–45/2014 ‹Menschenbetrachtung›.
- Henri Bergson ‹Denken und schöpferisches Werden›Frankfurt 1985 S. 270.
- Diese Wortbedeutung von Sinn als Richtung kennen wir heute nur noch vom ‹Drehsinn›.
- Martin Buber, Reden über Erziehung. Gütersloh 1953, S. 15.
- Youtube: Library scene (Wings Of Desire 1987)














Sehr geehrter Herr Held!
Warum heißt Elisabeth Wiegand mitten im Text plötzlich Marianne Wiegand? Habe ich da irgend etwas überlesen? Ließt das niemand quer?
Ansonsten ein netter Artikel.
mit lieben Grüßen
Michael Albert
Lieber Herr Albert, auch am besten gefilterten Suppe finden sich Haare. Aber auch nach fünfmaligem Lesen wird mir der Text immer schöner. Und vermutlich doch ich auch mit ihm?
Kann ich gut nachempfinden, gefällt mir.