Interview mit Gerald Häfner zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA am 3. November. Die Fragen stellte Wolfgang Held.
In einer Woche wird in den USA gewählt. Es ist schwer auszuhalten, in welcher Weise die Führungsmacht der politisch und wirtschaftlich bedeutendsten Nation bestimmt wird. Bis zum Wahltermin bleibt unklar, ob die Wahl fair abläuft, ob das Ergebnis am Ende den tatsächlichen politischen Willen der Mehrheit der Bevölkerung spiegelt, ja ob es überhaupt akzeptiert wird. Gleichzeitig lässt sich an dieser Wahl lernen, worauf es in einer funktionierenden Demokratie ankommt.

Das auf die Bundesstaaten bezogene Wahlsystem ist eigenartig – oder? Es führt beispielsweise dazu, dass in einem Großteil der USA so gut wie kein Wahlkampf stattfindet. Es tauchen kaum je Kandidatinnen oder Kandidaten auf, es wird nicht diskutiert, nicht mobilisiert. Diese Staaten gelten als fester ‹Besitz› der einen oder anderen Seite. Auf Karten werden sie als republikanische (rot) oder als demokratische (blau) Staaten markiert. Da am Ende nicht die Stimme des Einzelnen zählt, sondern nur die des Staates, spielt die einzelne Stimme in diesen Staaten kaum eine Rolle. Nur in wenigen Bundesstaaten, den Swing States, wird tatsächlich um die Wählerinnen und Wähler gekämpft, sodass die Bevölkerungen dieser Bezirke über das ganze Land entscheiden. Am Ende kommt es nur auf die Stimmen des Electoral College, der Wahlmänner, an und nicht auf die der Bürgerinnen und Bürger. Das führte dazu, dass zuletzt mehrfach die demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten etwa zwei Millionen Stimmen mehr erhielten (z.B. Al Gore gegen Georg W. Bush und Hillary Clinton gegen Donald Trump) und dennoch die republikanischen Kandidaten das Rennen machten. Wenn wir unter Demokratie verstehen, dass jeder Stimme das gleiche Gewicht zukommt, jede, wie es das deutsche Bundesverfassungsgericht ausdrückt, «den gleichen Zähl- und Erfolgswert haben» muss, dann ist das eine dysfunktionale Demokratie.
Ist auch der Zugang zur Wahl schwer? Man ist nicht automatisch Wählerin oder Wähler. Man muss sich als Wähler registrieren lassen. Diese Registrierung organisieren die politischen Parteien oder ihnen nahestehende Agenturen. Aus europäischer Perspektive kann man sich das kaum vorstellen. Entsprechend versuchen sie, diejenigen Bürgerinnen und Bürger zum Wählen zu bewegen, von denen sie aufgrund komplizierter Prognostik annehmen, dass sie die ‹richtige› Partei wählen. In einigen Staaten wird die Registrierung für bestimmte Bevölkerungsgruppen, meist Minderheiten, erschwert. Gefängnisinsassen zum Beispiel können sich gar nicht registrieren lassen. Teil dieses politischen Ingenieurwesens ist auch der Zuschnitt der Wahlkreise. In Deutschland werden Wahlkreise überparteilich bestimmt. Ich habe in der zuständigen Kommission zeitweilig mitgearbeitet. Dabei gelten klare Regeln. Alles ist gerichtlich überprüfbar. Anders in den USA. Beim Besuch eines Kongressabgeordneten sah ich in dessen Büro an der Wand die Karte seines Wahlbezirkes. Sie glich einer Wolkenlandschaft, denn sein eingefärbter Wahlkreis bestand aus verstreuten, nur zum Teil verbundenen Flecken. Wer die Wahl gewinnt, kann den Wahlkreis neu schneiden, sodass die Opposition den Wahlkreis nicht mehr gewinnen kann und die oppositionellen Stimmen verfallen. Wählerinnen und Wähler der Opposition werden oft in einem ‹Wegwerf›-Wahlkreis zusammengefasst, sodass viele überschüssige, für den Wahlerfolg nicht mehr benötigte Stimmen anfallen, die der Opposition dann in anderen Wahlkreisen fehlen.

All das wird zu einer Art politischem Geschäft. Mit Demokratie hat es weniger zu tun. Apropos Geschäft: All diese Partei- und Wahlkampfarbeit ist nicht öffentlich finanziert. Man braucht enormen Reichtum, um die Berater, Firmen, Kampagnen und Werbezeiten für den Wahlkampf zu finanzieren. Wer nicht Milliardär ist, braucht Geldgeber. Doch das macht abhängig. Denn wem die National Rifle Association (nra) den Wahlkampf finanziert, von dem erwartet sie Einsatz für freien Waffenbesitz. Erschwerend kommt hinzu, dass auch Gerichte parteipolitisch besetzt werden. Das lässt sich gerade beobachten. Der Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, hat einschneidende Urteile gefällt. 2010 zum Beispiel ‹Corporate Campaign Money›, wonach Firmen unbegrenzt Kandidatinnen und Kandidaten finanzieren dürfen. Die Begründung lautete, dass das verfassungsmäßige Recht auf freie Meinungsäußerung auch für Firmen gelten müsse. So wird Meinungsäußerung – und Politik – käuflich.
Die Wahl von Alexandria Ocasio-Cortez ist dann eine Ausnahme? Es gibt auch Hoffnung! Die New Yorker Kongressabgeordnete steht, wie andere noch, für einen neuen Politikertypus. Vor allem in Kommunen und Städten tut sich viel an sozialer und ökologischer Innovation und Bürgerbeteiligung. Es bilden sich neue zivilgesellschaftliche Netzwerke, statt von Geld und Macht von Idealismus und Engagement getragen. Ein Problem bleibt das Mehrheitswahlrecht. Das mitteleuropäische Verhältniswahlrecht versucht, die verschiedenen in einer Gesellschaft vorhandenen Auffassungen auch im Parlament zu repräsentieren. Das Zweiparteiensystem lässt kaum zu, dass gesellschaftliche Strömungen und Aufbrüche sich angemessen im Parlament wiederfinden. Politisch innovative Strömungen außerhalb der zwei alten Parteien haben keine Chance, gewählt zu werden. Nur wer die Mehrheit in einem Wahlkreis oder Bundesstaat gewinnt, kann ins Parlament einziehen. Deshalb versuchen die vielen zivilgesellschaftlichen Institutionen in den USA, Einfluss auf die Kandidaten auszuüben. Sie konkurrieren dabei aber mit bezahlten Lobbyisten, die Interessen von Verbänden und Konzernen vertreten. Präsidentschaftskandidaten wie Al Gore oder Bernie Sanders zeigen, dass diese zivilgesellschaftliche Kraft enorme Bedeutung entwickeln kann. Ich möchte den USA wünschen, dass anders als bei den letztmaligen und jetzigen Präsidentschaftsbewerbern erlebbar, künftig mehr Reflexion, Innovation und Transformation die Wahl- und Parlamentsdebatten bestimmt.

Wie sieht der Weg dazu aus? Demokratie braucht das Gespräch: Was Meinungsfreiheit passiv ist, das ist im aktiven Sinne die Fähigkeit, durch Argumente lernen zu können. Wer die Demokratie liebt, vertritt mutig seine Auffassung und akzeptiert zugleich: Nicht, was ich will, sondern was nach öffentlichem Austausch aller Argumente die meiste Unterstützung findet, soll Recht und Politik bestimmen. Die westliche demokratische Auffassung versteht Demokratie eher als Kampf zweier Haltungen, wobei die im Streit überlegene siegen möge. Dann gilt wie in den USA: ‹The winner takes it all.› Der Sieger bestimmt vier Jahre über Politik, Verwaltung, Richter … und oft über Krieg und Frieden. Die Entscheidung, wer das ist, ist folgenreich. Sie bestimmt über Kurs und Klima des ganzen Landes. Demgegenüber bemühen wir uns etwa in der Schweiz, in Dänemark, Österreich oder Deutschland um eine politische Kultur, in der die Opponenten Einigung viel öfter im Gespräch und Kompromiss suchen. Hier spiegeln sich unterschiedliche Mentalitäten, Kulturen und Begriffe von Politik und Demokratie.
Wie lernt man, Demokratie zu lieben? Um die Demokratie zu lieben, braucht man Selbstbewusstsein, Reziprozität und Kohärenz. Man hat starke Überzeugungen, kann sie artikulieren – und hat doch gelernt und erlebt, dass es besser ist, wenn nicht das geschieht, was eine Seite will, sondern dass erst durch den Prozess, in dem die verschiedenen Haltungen miteinander ringen, das Beste für alle entsteht. Es gibt eine Weisheit der vielen, die man, wenn der Prozess gesund ist, gnadenvoll erlebt.











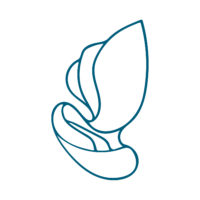


Lieber Herr Häfner, vielen Dank für diesen fundierten Einblick in das amerikanische Wahlsystem, ohne den das, was wir hier in den Medien über die Wahlen in den USA erfahren, gar nicht verständlich ist. Der Artikel wäre für die Leser jeder anspruchsvolle Zeitung ein Gewinn! – und gerade da setzt auch meine Kritik an: Wenn ein Artikel über das Zweiparteiensystem der USA in einem anthroposophischen Medium erscheint, könnte und sollte da nicht Bezug genommen werden auf die wesentlichen Hinweise, die Rudolf Steiner bereits 1916 (z. B. in GA 171) gegeben hat, z. B. über “Glücksstreben” (für alle) und “Utilitarismus” (für wenige) in Amerika: sie wechseln sich einfach ab als Ausdruck von politisch angewandter Dialektik! Macht es WIRKLICH so viel aus, welches der beiden Prinzipien für 4 Jahre vordergründig dominiert?
Mit freundlichen Grüssen
Wilburg Keller Roth