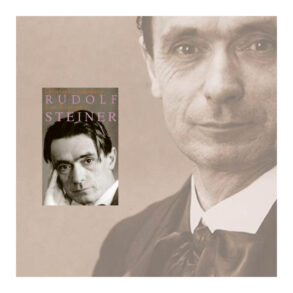Ein Jahr der Verunsicherung geht zu Ende. Mit dem Weihnachtsabend mündet der Strom der Krisen und Kollapse in die Stille der zwölf Heiligen Nächte. Diese Lücke in der Zeit öffnet einen Raum, der das noch nie Dagewesene einlädt. In der Dunkelheit der Pause hebt sich ein Vorhang. In 12 Miniaturen wird die Hoffnung zum Weglicht der Seele.
Die allertiefste Öffnung · Aina Bergsma
Was aus dem Feuer kommt · Jon McAlice
Himmelsfrucht · Konstanze Brefin Alt
Weil es gut ist · Günther Dellbrügger
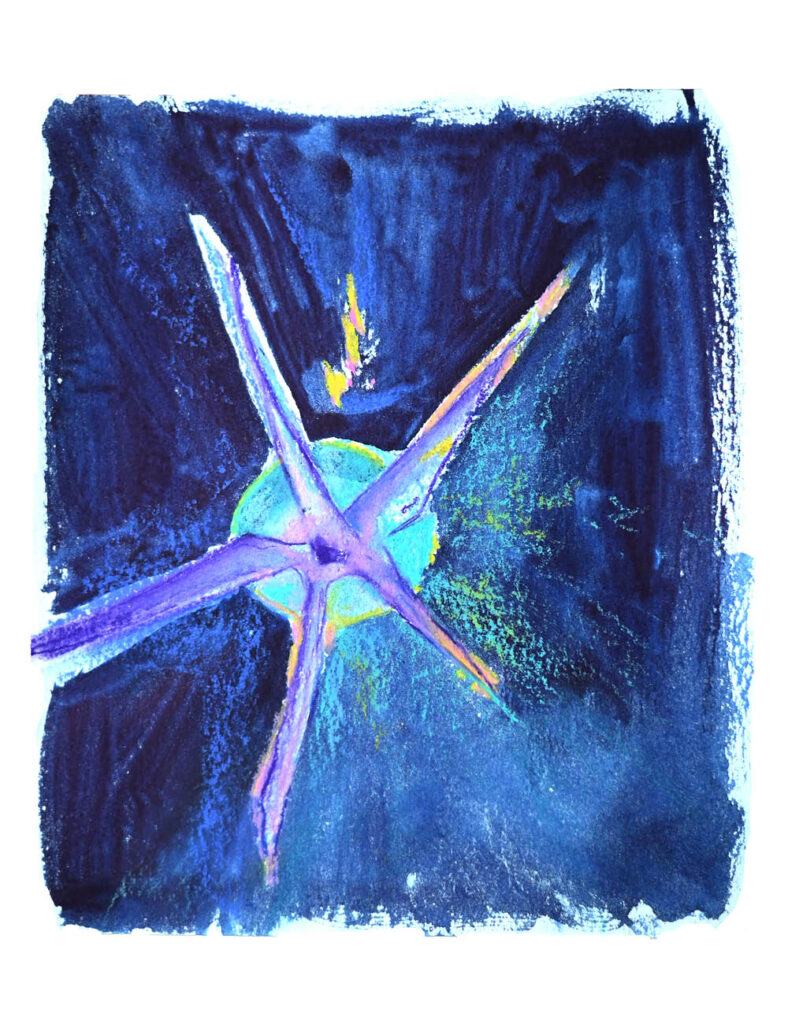
Die allertiefste Öffnung
Von Aina Bergsma
Eine Frau sagt ja und lässt das
Fremde, Keimende hinein,
sie lässt sich sprengen aus der
alten Form, die neue
kennt sie nicht, sie wohnt
im Harren, nichts ist
Wissen, nichts ist Sein, sie
wartet, wie im Frühling
Knospen an den kahlen
Ästen zittern bis zur Öffnung
– Alle sind sie in der Hoffnung.
Dann der neue Keim auf
Erdengründen, eingeladen
in das Reich der Sünde, steigt er
weinend, nackt und blind
hernieder, Leid erlebt er von der
ersten Stunde, Leid erlebt er
schutzlos immer wieder: Will er
dennoch seine neuen
Augen öffnen und sein Schicksal
wagen, will er – dann ist diese Öffnung
aus der Hoffnung.
Kind und Mutter: Keime für das
Neue, Teil der Schöpfung, die sich
stets entfaltet, leidend,
liebend, frei auf Erdenwegen,
geben sie sich hin zum Glück,
zur Sünde, inniglich
verbunden durch die
Stunde, als sie beide zitterten und
harrten, bis der Riss, die
allertiefste Öffnung
kam – und war Geburt der Hoffnung.

Was aus dem Feuer kommt
Jon McAlice
Der Ton kam aus der Erde und hat eine lange Geschichte, Erdgeschichte. Mein Freund grub ihn am Flussufer nördlich von unserem Haus aus. Er trocknete ihn, mischte ihn mit Lehm von anderen Flussufern und befeuchtete ihn mit Wasser, bis er weich und biegsam war. Eines Tages stellte er einen Eimer davon in meinem Atelier ab. Es war ein wunderschöner Ton, kühl und anschmiegsam. Ich mag es, wie er sich in meiner Hand anfühlt. Ich knetete ihn, bis er sich richtig anfühlte, und verbrachte dann den Nachmittag an der Drehscheibe, um ihn zu zentrieren, zu öffnen und zu einer Sammlung von Bechern, Tassen und Schalen zu formen. Der nasse Ton war von einem tiefen Blaugrau. Als die Stücke trockneten, wurde das Grau heller. Als sie vollständig getrocknet waren und sich nicht mehr kühl anfühlten, blieb nur noch ein Hauch der Dunkelheit übrig. Sie wurden unglasiert in einem traditionellen Holzbrennofen gebrannt. Das Brennen dauerte vier Tage, vom ersten Anzünden des Ofens bis zu dem Zeitpunkt, an dem er wieder kühl genug war, um ihn zu öffnen. Die Verwandlung, die dabei stattfindet, ist bemerkenswert. Die Töpfe, die wir in den Ofen stellten, waren zerbrechlich, in verschiedenen Grau- und Erdbrauntönen. Diejenigen, die wir herausnahmen, waren nicht mehr zerbrechlich, und sie waren auch nicht mehr grau und lehmig braun.
Ein großer Teil dieser Keramiksammlung ist inzwischen verschenkt worden. Ein paar Stücke sind geblieben. Eines davon steht auf dem Regal über meinem Schreibtisch. Es ist eine Yunomi mit Fuß, eine nicht zeremonielle japanische Teetasse. Auch sie hat sich beim Verlassen des Brennofens verändert. Einst war sie grau, jetzt hat sie eine warme nussbraune Farbe und glänzt golden im Sonnenlicht. Das Sternenlicht scheint bei der Alchemie des Ofens mitgewirkt zu haben, denn auf einer Seite ist sie mit kristallinem Glas bestäubt, das im Licht funkelt. Im Inneren sind die Brauntöne heller und auf einer Seite ist ein cremiges Weiß entstanden. Auch die Form des Bechers hat sich verändert. Nicht drastisch, sondern sanft, so als hätte das Feuer ihn in die Form gebracht, die er verdient. Der Fuß, die Rundungen der Schale, die leichte Unregelmäßigkeit des Randes: sie scheinen in perfektem Gleichgewicht zu sein; sie gehören zueinander. Zusammen sind sie wunderschön.
Das schöne Zusammenspiel von Form und Farbe, mit dem diese Tasse aus dem Feuer zurückkehrte, liegt jenseits der Weisheit des Handwerkers, die in meinen Händen lebt. Doch ohne den Handwerker hätte dieser Moment der verwandelnden Gnade keinen Samen, durch den er erblühen könnte. Jedes Mal, wenn ich zur Töpferscheibe zurückkehre, tue ich dies in der Hoffnung, dass das, was ich zu formen vermag, einer solchen Gnade würdig sein möge, denn ich weiß, dass sie immer nahe jenseits der Grenzen dessen liegt, was ich geworden bin.
Für einen Pilger gehen Hoffnung und Demut Seite an Seite. Wenn der Weg tückisch wird, geben sie sich die Hand. Wenn die Hoffnung schwankt, nimmt die Demut sie unter ihre Arme. Und wenn die eine von der Verheißung des Lichts in die Irre geführt wird, holt die andere sie auf den Boden zurück. Das sagten mir Hoffnung und Demut, als ich sie eines Tages im Frühling im Wald traf. Die Hoffnung schien sich dort am wohlsten zu fühlen. Sie lächelte und beugte sich oft vor, um einen neu geöffneten Keimling zu begrüßen oder eine aufkeimende Knospe willkommen zu heißen. Viele Jahreszeiten sind vergangen. Jetzt, da die Welt in unruhigen Winter taucht, frage ich mich, wo sie sind. Gibt es Menschen, die sie erkennen und ihnen Gastfreundschaft gewähren und sie in der Glut ihrer Herzen wärmen lassen? Ich werde heute Nachmittag zur Töpferscheibe zurückkehren. Vielleicht werde ich Yunomis formen. Und das in der Hoffnung, dass eine mit Schönheit aus dem Feuer zurückkehren wird.
Übersetzung W. Held

Himmelsfrucht
Konstanze Brefin Alt
Hoffnung ist zutiefst verbunden mit Weihnachten – hat doch, so Rudolf Steiner im 38. Wochenspruch, das «heilige Weltenwort gezeugt der Hoffnung Himmelsfrucht» – Jesu Geburt als Tor für Christus und seine Aufgabe in der Welt. In den 52 Wochensprüchen taucht das Wort Hoffnung noch zweimal auf: Ein paar Wochen vorher im Oktober, wo zunächst in der 28. Woche die Rede davon ist, dass die Seelensonnenmacht so manchem Wunsch Erfüllung verleiht, dem «Hoffnung schon die Schwingen lähmte»; und eine Woche später bildet sich mir aus «Weltengeistes Kräftequell» durch das Entfachen meines «Denkens Leuchten» mein «Sommererbe», meine «Herbstesruhe und auch Winterhoffnung». – Eine Bewegung also vom Überwinden einer hoffnungslos gewordenen Hoffnung, an der einzig die Furcht – und sei es die vor Veränderung – festhält, über einen Ausblick auf ein erwartetes Geschehen im Winter zur Zeugung des Höchsten, was Hoffnung vermag.
Schon diese drei Bilder machen deutlich: Hoffnung oszilliert. Sie kann der letzte Strohhalm sein – dies nur für ganz kurze Zeit –, sie kann beflügeln oder lähmen – manchmal beides gleichzeitig –, sich erfüllen oder eben nicht oder nur zum Teil. Ernst Blochs ‹Prinzip Hoffnung›, mit dem er zwischen 1938 und 1947 in drei Bänden als Philosophie der Konkreten Utopie einen Begriffskosmos geschaffen hat, ist da nur ein prominentes Beispiel dafür, wie weiträumig und vielschichtig Hoffnung als Seelentätigkeit oder -befindlichkeit ist.
Hoffnung bewegt sich zwischen innerer Aktivität und Passivität – aber die beiden Pole beschreiben letztlich auch die Grenzen, wo Hoffnung nicht mehr leben kann. Ich kann in Hoffnung nicht investieren: Ich kann nicht so und so viel Engagement in etwas, das ich mir erhoffe, hineingeben, um abzuschätzen, wie viel ich dann zurückbekomme oder wie wahrscheinlich sich das Erwünschte dann ereignet. Hoffnung ist nicht berechenbar. Und Hoffnung erlahmt oder überdreht und verliert den Boden, wenn sie sich nur im Wünschbaren bewegt. Wenn ich nicht beteiligt bin an dem, was ich erhoffe, kann sich darin Gift entfalten. Etwa wenn ich auf eine Veränderung oder ein Wunder bei anderen hoffe und mich als Opfer verstehe. Dabei übersehe ich, dass ich mich selbst in die Opferhaltung begeben habe und dadurch in Gefahr stehe, mich nicht nur dem zu entfremden, das ich nicht verändern kann, sondern gleichzeitig dem eigenen Umfeld und vor allem mir selbst.
Es geht um einen alchemistischen Prozess. Mit Weihnachten künden sich Christus und damit Erlösung an; indem wir dies miterleben, machen wir uns in der Seele, im eigenen Wesen, den Gottesgrund, die Verbundenheit mit Christus erlebbar und stärken sie. Es ist eine Art Schmelztiegel: Wir geben uns in diesen Prozess der Zeugung der «Hoffnung Himmelsfrucht» durch das «heilige Weltenwort» hinein und werden Teil davon.
Denn dadurch bekommt die Hoffnung Kraft, ohne dass sie formulieren muss, wie die Dinge sich zu entwickeln haben. Ihre Verbindung mit Weihnachten ist nämlich nicht zufällig. Liebe und Hoffnung sind nahe Verwandte; beide gedeihen nur bedingungslos. Jede Absicherung, jede Zielgerichtetheit, jeder Eigennutz bringt Gift in diesen Verwandlungsprozess – alles Haltungen, die zumindest Ausgleich suchen werden. Dies bedeutet: Ich muss mein Interesse an der Verwandlung selbst wecken, offen sein für Entwicklungen, die ich nicht erwarte, vielleicht nicht einmal wünsche.
Und da im Angesicht der vielen globalen Krisen nur Hoffnung bleibt, bin ich aufgerufen, nicht wegzuschauen, dabeizubleiben und, da ich äußerlich kaum tätig werden kann, dafür umso mehr innerlich präsent zu bleiben – auch für die Menschen, die in diesen Krisensituationen stürzen, auf welcher Ebene auch immer. Und das muss nicht heißen, passiv zu sein: Ich kann Teil des Prozesses werden, indem ich darauf achte, dass ich mich nicht beteilige am Urteilen, Aburteilen, Vermuten und Spekulieren – da ich die Zusammenhänge kaum wirklich verstehen und durchdringen kann. Aktives Schweigen weitet und öffnet den geistigen Raum, bildet Boden über einen selbst hinaus für Fragen, die weiterführen können.
Denn Hoffnung ist zutiefst darin begründet, dass die Brücke, die Verbindung zwischen physischer und geistiger Welt, der Mensch selbst ist. Und diese Potenz steckt in jedem Menschen, unabhängig davon, ob ich ihn mag oder wie sehr mich sein Handeln erschreckt.
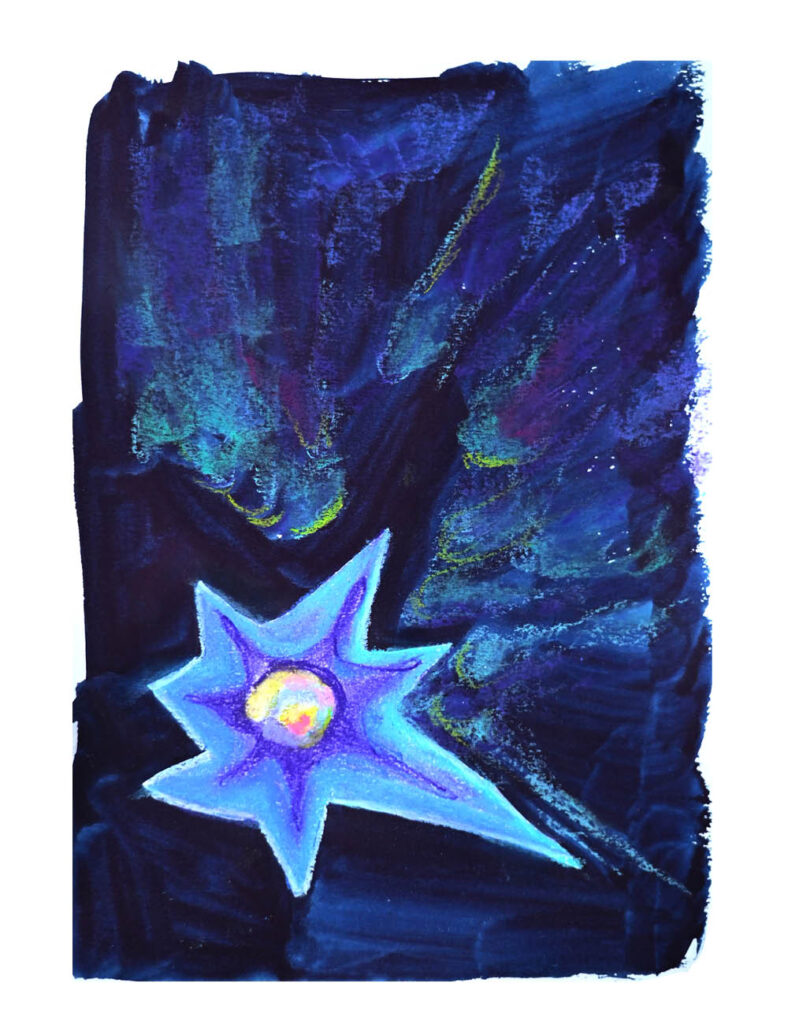
Weil es gut ist
Günther Dellbrügger
Am Morgen bekam ich die Frage nach einem Beitrag zum Thema ‹Hoffnung›, am Abend hörte ich einen Vortrag, ohne zu ahnen, dass beides etwas miteinander zu tun haben könnte. Der Vortragende, Matthäus Weiß, Landesvorsitzender der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein, setzt sich seit 45 Jahren für deren Rechte ein. Seine Mutter wurde aus dem Schulunterricht geholt, verschleppt und in verschiedenen KZs inhaftiert, unter anderem in Treblinka. Wie durch ein Wunder hat sie – anders als ca. 500 000 ihrer Landsleute – überlebt. Ihr Credo nach fünfeinhalb Jahren im KZ: ‹Keinen Hass – egal, was uns geschieht. Hass erzeugt Gewalt!›
Matthäus wächst nach dem Zweiten Weltkrieg in Kiel auf, als ältestes von 14 Geschwistern in einer Siedlung von ausrangierten Waggons, und erfährt viel Ausgrenzung und Kriminalisierung. Er will den Teufelskreis der ‹Völker ohne Raum› durchbrechen. Seine Wanderausstellung dokumentiert die jahrhundertelange Vertreibung der Sinti und Roma und die daraus resultierende Ausgrenzung in Europa. Seine Landsleute in der DDR waren anerkannt und wurden nicht sozial ausgegrenzt, das heißt, sie hatten Arbeit und Wohnung. Matthäus Weiß kämpfte in der BRD lange Jahre um eine solche Anerkennung, denn: «Es kann doch nicht sein, dass Tiere mehr Rechte haben als wir.»
Als erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes (1993–2005) war Heide Simonis in Schleswig-Holstein allseits anerkannt. In ihr findet Weiß eine prominente Unterstützerin: «Ich konnte immer zu ihr kommen, sie hatte immer ein offenes Ohr für uns.» Auch Günter Grass wurde ein tatkräftiger Unterstützer, indem er die Günter-Grass-Stiftung auch zugunsten der Sinti und Roma gründete. Weiß wurde ein Büro im Landtag in Kiel angeboten. Er lehnte ab: «Dann kommen meine Leute nicht mehr zu mir.» Nach und nach nahmen Vorurteile und Kriminalisierung ab und gegenseitiger Respekt wuchs. Doch erst 1990 wurde der Verband der Sinti und Roma als Verein anerkannt. Nach vielen Jahren Vorarbeit konnte 2006 in Kiel das schöne Wohnprojekt Mari Tamm (Unser Platz) für 13 Sinti-Familien mit viel Eigenarbeit als Genossenschaftsprojekt errichtet werden. Heute haben fast alle Sinti und Roma in der brd einen festen Wohnsitz. Es dauerte noch bis 2012, bis Sinti und Roma als eingetragene und zu schützende Minderheiten anerkannt wurden. Hoffentlich müssen dann Kunstschaffende wie Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Anna Netrebko, Drafi Deutscher und andere in Zukunft nicht mehr ihre Herkunft als Sinti oder Roma leugnen, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Sinti und Roma kommen ursprünglich aus Indien und haben sich in der ganzen Welt ausgebreitet. Bei einem Treffen in London – so erzählt Weiß – sprachen ihn sogar Afrikaner in der Sprache der Sinti an!
So zieht der 75-jährige Matthäus Weiß zusammen mit seiner von Sardinien stammenden Frau und seiner in vier Jahren aufgebauten Wanderausstellung ‹Kultur und Geschichte der Sinti und Roma – aus der Geschichte lernen› durch das Land, geht in Schulen, Behörden, Vereine, wohin auch immer er eingeladen wird. Unermüdlich, klar, aufrecht, ohne Hass, ohne Opferhaltung, ein Mensch! Nach dem Vortrag fielen mir die Worte von Václav Havel wieder ein, in denen er beschreibt, was er mit Hoffnung verbindet: «Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal, wie es ausgeht.» Und: «Hoffnung ist ein Geisteszustand …, die Fähigkeit für etwas zu arbeiten, weil es gut ist.» Zu seinem Vortrag waren acht Menschen gekommen. •
Matthäus Weiß wurde ein Büro im Landtag in Kiel angeboten. Er lehnte ab: «Dann kommen meine Leute nicht mehr zu mir.»
Das Goetheanum 51-52 · 2024
Hao Bu
Ein Wollen zum Zukünftigen
A
ls irdischer Mensch pendle ich zwischen Hoffnung, Wunsch, Erwartung, Frustration und Verzweiflung. Auf meinen Werdegang zurückblickend frage ich mich: Wie hast du die Lebensherausforderungen bzw. -krisen gemeistert, sodass dein Leben sich von einem Zustand zum anderen metamorphosiert hat und du wachsen konntest? Die Antwort heißt: durch Hoffnung. Ich habe nicht etwas erhofft, sondern ich habe gehofft. Wenn ich ‹auf etwas› gehofft hätte, könnte das Wort ‹hoffen› durch ‹wünschen› oder ‹erwarten› ersetzt werden und es verlöre seinen Sinn. Im Grunde hat die Hoffnung keinen Inhalt; sie ist noch voller Substanz. In diese innere Tat des ‹Hoffens› tauche ich ein und kann in ihr nichts finden – doch ich werde erwärmt und von etwas Zukünftigem angezogen. Woher stammen diese Wärme und diese Anziehungskraft? In meinem Innern taucht das Bild eines kleinen Kindes auf, das gehen lernt. Bei den ersten Versuchen, sich aufzurichten, fällt es unzählige Male hin, steht immer wieder auf und versucht es von Neuem. Was geschieht zwischen einem Fall und einem neuen Versuch? Das Kind verfügt über keinerlei Sicherheit, dass sein Versuch von Erfolg gekrönt sein wird. Warum steht es trotzdem immer wieder auf?
Weil es sich von etwas Zukünftigem angezogen fühlt, das es erwärmt und ermutigt. Das Hoffen und das Angezogensein sind wie zwei Seiten einer Medaille: eine vom Aktiven und Jetzigen her betrachtet, die andere vom Passiven und Zukünftigen. Wir alle haben das Aufstehen erlernt und den Rhythmus vom Fallen und Sich-Erheben erlebt – dieses Lernen hat sich unbewusst und von instinktivem Lebenswillen erfüllt vollzogen. Gibt es ein geistiges Aufstehen? Das Tier bewegt sich horizontal und kann sich nicht aufrichten (lassen) – es hat keine ‹Ich-Organisation› und wird nicht vom Himmlischen in die Aufrechte geleitet. Ein körperliches Ich muss sich der Mensch während einigen Monaten erringen, aber ein geistiges Ich? Ein ganzes Leben reicht vielleicht dafür nicht aus. Was kann uns in diesem Lernprozess treu begleiten und uns frische Kraft verleihen, damit wir immer weiter versuchen, uns aufzurichten, Fehler zu machen und unsere seelischen Grenzen zu durchbrechen bzw. zu erweitern? Die Hoffnung.
In frühchristlicher Zeit und im Mittelalter ist die Hoffnung unmittelbar mit Glauben und Liebe verbunden gewesen, im Zeitalter der Bewusstseinsseele geht sie nun eher mit von Liebe durchdrungener Erkenntnis einher. Den Drang, sich innerlich aufzurichten und sich zum Ideal hin zu entwickeln, verspürt jeder Mensch, nur wird der Entwicklungsgang gelegentlich unterbrochen oder blockiert. Dieser Drang klopft an jedes Herz – unermüdlich. Leider sind wir aufgrund von Nebengeräuschen oft nicht mehr in der Lage, hinzuhören. Hoffnung bedingt aber, Zukünftigem lauschen zu können. Hoffen und Erkennen fördern und befruchten sich gegenseitig. Das Hoffen bringt dem Erkennen eine Sehnsucht und eine Hülle, nämlich eine Gebets- und Gnadenstimmung entgegen, während das Erkennen dem Hoffen eine tiefe Einsicht in das ‹Hier und Jetzt› sowie die Zukunft verleiht. Es sollten hoffendes Erkennen und erkennendes Hoffen als Zwillinge geboren werden.
Hoffen ist eine Zauberkraft, die dem Menschen ermöglicht, Widerstände als Schmelztiegel zum Schmieden des Willens nutzbar zu machen und den Lebensschatten in kostbare Erfahrungsnahrung umzuwandeln. Hoffen führt mich mit Wärme abends ins Jenseits des irdischen Lebens und lässt mich am Morgen mit frischen Kräften aufwachen. Hoffnung ist die Morgen- und Abendröte. •
Isabell Klara
Hoffnung, wer bist du?
u Stille, Zarte, du, die keinen Ort hat als in uns, irgendwo in den Hinterkammern unserer Gesichter. Du Unsichtbare und allen Sinnen Ferne. Du, die die Kraft hat, in einem Einzelnen wirklicher zu sein als die sogenannten allgemeingültigen Tatsachen. Du, die die wirklich tiefsten Wünsche in sich beherbergt, denen die Umstände und die Zeit gerade nirgendwo anders Aufenthalt gewähren. Du machst größer und schöner, und die, die dich nicht haben, sind die Grauen und etwas zu tief im Materiewiderstand Klebenden, die, die meinen, die Erde sei wirklicher als der Himmel. Hoffnung, du Unabhängige. Du Fantasie- und Freudenahe. Du hast die Kraft, leuchten zu lassen, ja, nicht du leuchtest, du erregst Leuchten in dem, der dich in sich hat. Und du gibst die Kraft, für möglich zu halten, was niemand sonst als möglich erlebt, und so kann das Ungeformte, Nichtseiende getragen werden. Wer kann dich wegnehmen? Schlechte Geschehnisse, die immer in dieselbe Richtung zielen, oder die Entscheidung, dich als Illusionstendenz zu beurteilen. Aber nichts nimmt dich für immer; immer bist du bereit, doch bei denen, die bisher ohne dich sein wollten, aufzutauchen. Du, die das Leben und den Frieden liebt. Du Menschliche. Du, Hoffnung, du hast kein leitendes Geländer wie der Glaube. Du kannst nur aus der eigenen Kraft eines Menschen leuchten, ohne Form, ohne Bild, ganz ins Offene hinein. Als wärst du eine Frage, zu deren heller Antwort man sich auf den Weg macht, ohne irgendetwas daran greifen zu können.
Spricht in dir nicht tief der eigene Wille, der weiß, dass er jetzt nichts für sich tun kann, als das noch Unreale in Zukunft für möglich zu halten? Gibt der Wille sich in dir nicht einen Ort, der ihn vor Verzweiflung, Angst und Unrast schützt, ohne sich selbst darüber hinwegzutäuschen, dass das Gewollte nicht anwesend ist?
«Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.»1
Aber ist die Hoffnung nicht nur Vorstellung? Nein, denn sie ist nicht von Bildern befüllt. Oder ist sie nicht nur Privatwunsch? Nein, denn genauso, wie sie mit mir selbst verbunden ist, spannt sie mich in ihren großen Raum, der mich übersteigt. Aber haben nicht die Hoffnungslosen der Erfahrung nach recht? Ja, aber aus der Erfahrung kommt keine Zukunft.
Hoffnung, du Leere, Edle, du zuletzt Sterbende,ich lebe mit dir. •
D
Aber nichts nimmt dich für immer; immer bist du bereit, doch bei denen, die bisher ohne dich sein wollten, aufzutauchen.
1 Paul Fleming, Gedicht ‹An sich›.
Bastiaan Baan
Die Lichtquelle des Körpers
U
nsere Augen vermögen sich anzupassen an Dunkelheit. Laufen wir aus dem Sonnenlicht in eine dunkle Grotte oder einen Tunnel, dann sind wir erst desorientiert. Oder wenn wir nachts von einer hell erleuchteten Straße aus einen dunklen Wald betreten, kann uns die Finsternis vielleicht sogar beängstigen. Aber wenn wir Geduld haben, bemerken wir, dass unsere Augen sich langsam an die Dunkelheit gewöhnen und dass wir anfangen, unsere Umgebung zu erkennen. Dies ist die beste Art, um die Angst vor der Finsternis zu überwinden: Begib dich Schritt für Schritt in einen dunklen Raum; warte, bis du vertraut bist mit der Dunkelheit – und du fängst an zu sehen.
Diese Gesetzmäßigkeit gilt nicht nur in der physischen Welt, sondern auch in der geistigen. Täglich werden wir konfrontiert mit einer Welt düsterer, abscheuerregender Ereignisse. Wir wollen sie gewöhnlich überhaupt nicht sehen. Wir wenden uns ab und versuchen, uns forciert der leichten Seite des Lebens zuzuwenden. In unserer heutigen westlichen Welt gibt es sogar eine Aversion gegen jegliche Art von Dunkelheit: Wir wenden uns ab von Kranken, Sterbenden, Hungrigen, Flüchtenden und Menschen, die das Gesetz gebrochen haben. Wir wollen die dunkle Seite des Lebens nicht sehen. Oder haben wir etwa Angst davor?
Als Christus über das Auge als Lichtquelle des Körpers sprach, erzählte er keine Parabel, sondern er meinte die tägliche Realität. Nicht die schlechte Welt macht uns schlecht. Es ist auch nicht die Finsternis außerhalb, die uns innerlich verdunkelt. Es ist die Art, wie wir die Welt sehen, die uns Dunkel oder Licht bringt.
Die Frage ist nicht: Was sehe ich? Sondern: Wie sehe ich? Sehe ich die Welt mit Angst, mit Abscheu – oder sogar mit Hass? Oder sehe ich dieselbe Welt mit Mitleid und Liebe – trotz aller Finsternis? Diese subtile Art des Schauens erhellt nicht nur uns selbst, sondern wird schließlich auch die Finsternis um uns herum erhellen.
Eine Mutter, die ihre beiden Kinder verloren hatte, schrieb nach langer Zeit von Rebellion, Trauer und Depression: Wenn ich konzentriert und liebevoll in die Finsternis schaue, dann sehe ich Licht. •
Vesna Forštnerič Lesjak
Du musst jemanden lieben
E
s gab immer in der Menschheitsgeschichte in dieser oder jener Hinsicht dunkle Zeiten. Nie waren nur Friede, Liebe und Freude auf der Erde. Und gleichzeitig wurden die Menschenseelen in schweren Zeiten immer mit einem kleinen Licht oder manchmal auch von einem größeren leuchtenden Stern angezogen, Hindernisse überwindend, um einer besseren Zukunft entgegenzugehen. Was kann für uns in dieser Zeit ein leuchtender Stern sein?
Ich erinnere mich an einen Vortrag von dem großartigen anthroposophischen Arzt Ratimir Šimetin aus Zagreb, den er für unser slowenisches Publikum vor vielen Jahren gehalten hat. Er sagte: Jeder Mensch braucht im Leben, vor allem wenn er jung ist, mindestens einen Menschen, der ihn wirklich liebt, um eine gesunde Entwicklung durchlaufen zu können. Es kann die Mutter oder der Vater sein, oder ein anderer Mensch, auch jemand, der nicht verwandt ist. Das hat mich damals tief berührt. Kann man sich das klar genug vor Augen führen? Unsere Entwicklung hängt im Leben davon ab, ob wir geliebt werden, ob mindestens ein Mensch es wirklich schätzt, dass wir auf der Welt sind. Das ist eine ungeheure Verantwortung gegenüber anderen Menschen.
So scheint es in diesem Zeitalter der Bewusstseinsseele, dass wahrscheinlich alle schönen Begriffe, wie auch die Hoffnung, mit unserer Verantwortung eng zusammenhängen. Man kann sich selbst fragen – liebe ich mindestens einen Menschen wirklich? Und sind alle, die ich kenne, mindestens von einem Menschen geliebt, sodass sich alle um die Erdkugel herum Hände und Herzen reichen können? Wie viele Menschen sind sehr einsam, in schwierigen Lebenssituationen? Und trotzdem kann man im Leben in den schwierigsten Situationen manchmal erfahren, dass auch in der eigenen Seele die notwendige Kraft zu finden ist – als eine Christus-Flamme. Aber nicht alle finden sie. Unser slowenischer Dichter Tone Pavček (1928–2011) schrieb dazu:
Die Welt
Du bist auf der Welt, um in die Sonne zu schauen.
Du bist auf der Welt, um der Sonne zu folgen.
Du bist auf der Welt, um selbst die Sonne zu sein – und Schatten aus der Welt zu verbannen.1
Hoffnung scheint rätselhaft und nicht selbstverständlich zu sein. Auch wenn wir in die Natur schauen, sind heute viele Wesen und Landschaften bedroht, die ganze Erde als Organismus ist bedroht und wir gehen – wenn wir in unserem bisherigen Stil verharren – als Menschheit einer Katastrophe entgegen. Wer liebt die Erde? Wo ist da die Hoffnung zu finden?
In der goetheanistischen Naturanschauung sprechen wir oft über das wache Interesse für ein anderes Wesen als ein Eingangstor zur wahren Liebe. Liebe ist das Interesse für ein anderes Wesen. In diesem Sinne würde ich die Hoffnung mathematisch als eine Summe einzelner wahrer, nicht egoistischer Interessen für die Entwicklung anderer Wesen bezeichnen. In diesem Sinne soll diese Bezeichnung ein Aufruf für uns alle sein, noch mehr Interesse für den Mitmenschen, für andere Mitwesen wie auch für die geistige Welt zu entwickeln. Ein anderer slowenischer Dichter Ivan Minatti (1924–2012) formulierte diesen Aufruf so:
Du musst jemanden lieben
Du musst jemanden lieben,
sei es Gras, Fluss, Baum oder Stein,
du musst jemandem die Hand auf die Schulter legen,
sodass sie – hungrig – mit der Nähe gesättigt werden kann,
zu jemandem musst du, du musst,
es ist wie Brot, wie ein Schluck Wasser,
du musst deine weißen Wolken hergeben,
deines kühnen Vogels Traum,
deines schüchternen Vogels Hilflosigkeit
– es muss irgendwo für ihn
ein Nest des Friedens und der Zartheit sein –,
du musst jemanden lieben,
sei es Gras, Fluss, Baum oder Stein,
denn Bäume und Gras kennen die Einsamkeit
– weil die Schritte immer weiter gehen,
auch wenn sie kurz anhalten –,
denn der Fluss weiß um die Traurigkeit
– wenn er sich nur über seine Tiefe beugt –,
denn der Stein kennt den Schmerz
– wie viele schwere Füße
sind schon über sein stummes Herz hinweggegangen –,
du musst jemanden lieben,
du musst jemanden lieben, mit jemandem Schritt halten,
in der gleichen Spur –
oh Gras, Fluss, Stein, Baum,
stille Begleiter von Einzelgängern und Seltsamen,
gute, große Geschöpfe, die nur sprechen,
wenn die Menschen schweigen. •
Das Goetheanum 51-52 · 2024
1 Beide Gedichte sind voller Bescheidenheit von der Autorin übersetzt.
Das Goetheanum 51-52 · 2024
Hanna Sharma
Zusammenklang
Unser Sein endet nicht an der Grenze unserer Haut, es pulsiert weit darüber hinaus und ist in ständigem Gespräch mit allem um uns herum.
W
illkommen. Wir sind über eine Schwelle getreten. Hier ist ein Ort der Ruhe, der Stille, des Seins. Das Herz schlägt gleichmäßig in seinem ureigenen Rhythmus. Blut strömt in die eine und die andere Richtung. Der Atem kommt und geht und webt eine Verbindung zwischen Außen- und Innenwelt. Die Lungenflügel umarmen das Herz in seinem Tun, bewacht vom Brustbein. Die knöcherne Beckenschale lauscht den Bewegungen und Tönen unserer Bauchorgane. Die Zellmembranen sind Meisterinnen der durchlässigen Kommunikation, und das Nervensystem gibt auf uns Acht, ohne dass wir es je darum gebeten haben. Unser Stoffwechsel verdaut Erfahrungen und formt sie um in einen Kompost aus Lebendigkeit. Jede einzelne Zelle ist ihrer ganz eigenen Bestimmung gewidmet. Alles hier ist radikal für uns. Überall strömt Leben, bahnt sich seinen Weg, findet Umwege, ist nicht aufzuhalten. Unser Sein endet nicht an der Grenze unserer Haut, es pulsiert weit darüber hinaus und ist in ständigem Gespräch mit allem um uns herum. Die Gewebe beziehen sich auf die Schwerkraft der Erde, unser Mikrobiom teilen wir mit allem, was wir anfassen, und der Atem synchronisiert sich mit dem Atem der Menschen, die uns umgeben. Alles, was wir berühren, Holz, Felsen, Baumrinde, die Haut eines anderen Menschen, all das berührt zugleich auch uns. Wie viel unserer Präsenz können wir diesem großen Zusammenklang gerade schenken? Wie können wir in gegenseitiger Bezogenheit einander lauschen? Wo können wir jetzt oder gleich noch ein winziges Stück mehr aus dem Weg treten? Und können wir etwas von uns ebenso großzügig hinschenken in dem Vertrauen, dass es auf diese Weise nicht weniger wird, sondern mehr? Mit jedem Bruch entsteht mehr Weite. Dunkelheiten steigen auf, verändern ihre Form in unserem Gewahrsein und entladen sich wieder als kollektive Medizin in den Körper der Erde. Und so verabschieden wir uns wieder von unserem Ort und treten über die Schwelle. Wissend, dass unsere Zellen wissen. •
Bonnie Baker
Im Spiegel der Natur
W
as braucht es, um in einem Moment völliger Verzweiflung innere Stärke zu finden? Es ist unsere merkwürdige menschliche Fähigkeit, uns wieder aufzurichten, uns vom Staub zu befreien und es erneut zu versuchen. Es bedarf eines Willens, der oft erst dann in einen Menschen dringt, wenn er schon aufgegeben hat, wenn die Chancen schlecht stehen. Er taucht in jenem Moment der Gnade auf, wenn ‹alle Hoffnung verloren ist›, aber aus Herzenstiefe der Impuls zum Weitermachen kommt.
Ich denke oft an das Foto vom Januar 1923 mit der feierlichen Gestalt, die auf den Ruinen des Ersten Goetheanum steht – ein tiefes und überzeugendes Zeugnis für die Vergänglichkeit der materiellen Welt. Es löst ein eindringliches, intuitives Empfinden von Verlust und Zerstörung aus. Menschen aus 17 Nationen arbeiteten neun Jahre lang an diesem Bau, der in einer Welt am Rande des Krieges nur für eine flüchtige Weile Bestand hatte. Vielleicht war die Vergänglichkeit selbst Teil der Erlebbarkeit dieses Bauwerkes, wie bei einer Sandburg oder einer Blüte.
Zur Zeit des Neubaus des Zweiten Goetheanum herrschte in der Welt eine große Feindseligkeit gegenüber der Anthroposophie. Der Wiederaufbau war ein kühner Akt von Hoffnung und Trotz zugleich. Rudolf Steiner hatte weder Angst, noch zögerte er angesichts der totalen Zerstörung, als ob es keine andere Frage gäbe, als weiterzumachen – ein Sinn für die innewohnende Güte und den Lebensauftrag und ein Schritt, als ob er die Zukunft herbeiruft, damit sie im unmittelbaren Augenblick geschieht. Das Wesen dieses Bemühens ist nicht flexibel oder nachgiebig, es ist eisern und begleitet von uneingeschränktem Vertrauen in das Potenzial der Zukunft und in die Gemeinschaft der Hüter, die am Weitermachen beteiligt sind.
Eine latente, aber wesentliche Willenskraft in der menschlichen Konstitution treibt uns voran. Obwohl manchmal unentdeckt, gibt es Zeiten, in denen eine Reihe biografischer Umstände, die durch unsere eigenen Anstrengungen beschleunigt werden, unsere Resilienz offenbaren und aktivieren. In der Natur staune ich darüber, dass sie keine andere Wahl hat, als ihre Kräfte zu leben – Kräfte, welche die Blätter im Herbst von den Bäumen fegen oder sie im Frühling wieder erneuern. Die aktive Anregung ist in der Natur so ganzheitlich und offensichtlich, dass sie die ganze Atmosphäre durchdringt. Wir sehen sie in den Momenten, in denen die Knospe aufwacht und durch den Frost bricht, der Same aus seinem Schlummer zum Sprießen gebracht wird. Ich spüre sie als Mut der Gewissheit, gemischt mit einer tiefen Sehnsucht.
Die Entschlossenheit des Willens, die als formende Kraft in der Natur sichtbar wird, spiegelt sich als Hoffnung im menschlichen Wesen wider – eine heilende Kraft, die den physischen Körper formt und die Seele zum Erwachen einlädt. Die Entwicklungsreise unserer Seele erwacht im Wechsel von Harmonie und Zerwürfnis, von Liebe und Verlust, im Wechsel der Jahreszeiten. Wie die erneuernde Kraft in der Natur ist der Drang, mit Ausdauer, Eifer und Erwartung vorwärtszugehen, unserer konstitutionellen Natur angeboren. Er wird umso mehr geweckt, wenn er zwischen Menschen geteilt und in der Gemeinschaft genährt wird.
Diese Woche hielt ich inne, um zu sehen, wie das Goetheanum und die Umgebung mit dem ersten Schnee der Saison bedeckt wurden. Ein so tiefer Frieden entstand in mir, als der Schnee am Abend fiel und die Erde still wurde, aufnahmefähig und ruhig. Ich begrüßte den nächsten Tag aufgeregt. Die Landschaft glitzerte in einer weißen Decke und die Kinder waren mit ihren Schlitten unterwegs und genossen es. Es war ein freudiger Moment in seiner Schönheit und Kürze. Ich wusste, dass der Schnee nicht lange anhalten würde und der Moment, ihn zu genießen, nicht aufgeschoben werden konnte. Es war ein Moment, um sich ganz und gar hineinzuleben; inmitten einer unsicheren, beunruhigenden Welt zum Guten und zur Erneuerung genötigt, die schon in der Atmosphäre und in der Erde selbst lebendig sind. •
John Bloom
Quelle des Willens
Zu meinem Erstaunen hat die Hoffnung keine Bedenken, von vorn zu beginnen.
D
ie Hoffnung ist meine auf mich zukommende imaginäre Zukunft. Wenn ich ihre Anwesenheit bemerke, wird mir auch klar, dass ich sie eingeladen habe, und dass ich verantwortlich bin, ihr Gestalt zu geben. Der Weg, den sie auf mich zu nimmt, ist jedoch ein Geheimnis. Manchmal wird sie von einem Engel begleitet, oder von den Ahnen, oder von einer Schar anderer, die die Zukunft der Zukunft bewohnen. Manchmal kommt sie mit überraschender Geschwindigkeit von ihrer Reise an, manchmal tief erschöpft, manchmal besiegt, immer jedoch aufsässig kühn. Zu meinem Erstaunen hat die Hoffnung keine Bedenken, von vorn zu beginnen. Das ist ihre schöpferische Essenz. Die Hoffnung erweckt die Fähigkeit, die Zukunft in die Realität zu spielen, zu schreiben und zu singen. Das ist meine Hoffnung. Was ist mit Ihrer?
Ich weiß, es gibt jene, die leiden, weil ihnen Hoffnung fehlt. Ohne Hoffnung scheint sogar die Gegenwart sinnlos. Ich frage mich, welche ‹böse Macht› das Wesen der Hoffnung so schmälern kann? Wenn jemand sagt, er hat keine Hoffnung, wird mir bewusst, dass mir nie gesagt wurde, dass ich nicht hoffen kann. Welch ein Privileg! Für jetzt jedoch lege ich meine Hoffnung beiseite, damit ich präsent bin für ihre Abwesenheit in anderen, so wie die Hoffnung geduldig das Erkennen dessen erwartet, was sie ermöglicht. Einmal geweckt, kann sie ein Ruf durch starke Verzweiflung hindurch sein.
Das Geniale an der Hoffnung ist ihre Fülle und Fähigkeit, sich selbst zu erneuern, manchmal mit nur einem Atemzug. Wie auch ihre Begleiter, Glaube und Liebe, strahlt ihr Wesen ein warmes, anziehendes Feld aus und bestärkt zugleich unsere sozialen Bindungen.
Geheimnisvollerweise kann die Hoffnung als Meditation dienen. Sie kann auch ein Gebet sein, das ich im Dienst der Hoffnungen anderer darbringe. Während ich dies schreibe, landen die entstehenden Bilder in Worten, von denen ich hoffe, dass sie meiner Erfahrung wahrhaftig entsprechen. Diese Hoffnung wird von einer zweiten begleitet: Ich hoffe, dass die Sprache eine Brücke ist, die uns verbindet und beim Überqueren zu einer Spende für die geistige Welt wird. Für jene, die die Schwelle überschritten haben, inspirieren unsere Hoffnungen ihre Zukunft. Die Tat der Hoffnung, das Hoffen, hat, wie jede Handlung, die wir in der Welt vollziehen, lange Auswirkungen über Zeit, Raum und sogar Inkarnationen hinweg. Hoffnung formt so die Welt, ist Teil ihres Ethos und ihrer Bestimmung. Sie wird dann, verwandelt als Geschenk, ein Teil der Gestaltung unserer Zukunft. Dieses Geschenk ist eine grundlegende und generative Energie, die Quelle des Willens und elementar für das Wohlbefinden. Ich nehme die Hoffnung nicht auf die leichte Schulter, und doch wird sie leicht. •
Christine Gruwez
Blinkt so wie ein Stern
D
ie Hoffnung kommt nie allein.
Wenn sie kommt, erscheint sie inmitten des Glaubens und der Liebe: ein Dreigestirn. Die Hoffnung in der Mitte. Alle haben sie ein unermesslich langes Reisen hinter sich. Der Glaube glänzt aus reiner Zuversicht, die Liebe strahlt aus reiner Kraft. Die Hoffnung aber blinkt so wie ein Stern, der auf seiner Bahn zu viele Staubkörner aufgefangen hat. Sie wirkt klein, wie in sich selbst geduckt. Als ob sie sich sträubt. Ein rebellisches Kind. Ein einsames Kind.
Einmal kann es so aussehen, als ob sie ganz allein dasteht. Ist sie vielleicht vom Glauben und von der Liebe verlassen worden? Ein anderes Mal verschwindet sie fast unter diesem erhabenen Gewicht ihrer beiden Mitgesellen.
Der französische Dichter Charles Péguy schrieb im Jahr 1912 eine ‹Hymne› auf die Hoffnung, die er «ein kleines Mädchen» nannte. In diesem Jahr hatte er im Zeichen der Hoffnung eine Fußreise nach Chartres gemacht, weil sein Sohn krank war. Er heilte seine eigene Seele, die ihre Innerlichkeit wiederfand. Viele Pilgerwanderungen folgten darauf noch. Péguy starb am 5. September 1914 in den allerersten Kriegstagen an der Front in der Nähe von Meaux, dass sich auf diesem Pilgerweg nach Chartres befindet.
In seinem dichterischen Lobsang heißt es, dass sogar Gott sich wundert, wenn er die Hoffnung anschaut; er wundert sich über «cette petite fille de rien du tout» – dieses kleine, unscheinbare Mädchen, das keinerlei Aufsehen erregt. Dennoch, sagt sich Gott, ist sie es, die in ihrer eigentümlichen Art und Weise Glauben und Liebe voranzieht. Denn sie allein ist fähig, dasjenige zu sehen, was es noch gar nicht gibt. Und das sich so darstellt, als ob es nie da sein würde.
Sie schaut nicht nur dahin, sie liebt über alles das Nicht-Seiende, weil es reine Möglichkeit ist und bedeutet, die Tür ununterbrochen offen zu halten. Eine geschlossene Tür hieße schon Vorbestimmtheit oder Erwartung, aber sie ist Hoffnung.
Zwischen den Pfeilern Glaube und Liebe spannt sie den allumfassenden Bogen, ähnlich einer Brücke, auf der Vergangenes und Zukünftiges sich immer neu begegnen. Wo Liebe Zuversicht und Zuversicht Liebe wird und die Zeit sich verwandelt. Denn sie, die Hoffnung, ist die Öffnung. Jedes Mal, wenn Zeit und Ewigkeit einander berühren, ist sie zugegen.
Ständig wehen die Stürme des Zeitgeschehens, die kleineren und größeren, unter diesem Bogen durch und legen sich wieder nieder. Düstere Himmel gehen in geklärte Himmel über und wieder zurück.
Diejenigen, die sich durch diesen Bogen ins Unbekannte begeben, schauen einander mit ehrfürchtigem Staunen an. Sie wissen nicht, ob es weitergeht. Sie wissen nur, dass sie gehen. Und sie hören nicht auf, sich zu wundern über diese vorher noch nie erlebte Leichtigkeit. Wie wurde ihnen das Herz so voll und leicht zu gleicher Zeit? Manche drehen sich noch ein letztes Mal um. War da nicht irgendwo an dieser offenen Tür ein kleines Mädchen? Wo kann sie bloß geblieben sein?
Sie ist in Ihnen. Schon längst. Und wächst mit jedem Schritt. •
Das Goetheanum 51-52 · 2024
Charles Péguy,7.1.1873–5.9.1914,‹Le Porche du mystère