Die Pandemie zeigt sich als globales Geschehen von erheblicher Tragweite, das Grundstrukturen unseres Verhältnisses zueinander und zur Welt freilegt. Wenn wir zunächst versuchen, dieses Geschehen selbst zu verstehen, seinen Fortgang und seine Größe zu ermessen, zerfächert sich die Deutung sogleich in die unterschiedlichsten Perspektiven.
Es gibt Bedingungen, ohne die das Virus nicht aufgekommen wäre, sich nicht hätte so schnell verbreiten können, die Reaktionen darauf nicht so ausgefallen wären, wie sie ausgefallen sind, ohne die die Auswirkungen dieser Reaktionen nicht so tiefgreifend wirken würden. Das Aufkommen des Virus und seine Verbreitung ruft nach Erklärungen: ein Überspringen vom Tier auf den Menschen, eine gefährliche Kombination von Infektuosität und Neuheit, unser Verhältnis zu Wild- und Nutztieren, Entschlossenheit oder Versagen von Regierungen, gewisse Prioritäten in Verwaltungen und Gesundheitsindustrie. Wir können andererseits in der Pandemie und den Maßnahmen dagegen einen Sinn entdecken: Sie prüft unsere Lebensform und offenbart ihre Schwachstellen, lässt an vielen Stellen Ruhe und Besinnung einkehren, konfrontiert uns mit unserer Endlichkeit. Sie holt die Handlungsfähigkeiten von Staaten und ihr Machtgefüge aus der Latenz, sie profiliert gesellschaftliche und globale Ungleichheiten, animiert zu solidarischem Verhalten und Handeln, verdeutlicht ungeahnte Veränderungsmöglichkeiten und hat uns wie in unwirklichen Leuchtbildern die Vorteile einer radikalen Dekarbonisierung vor Augen geführt. Als Ereignis der Geschichte ist die Pandemie der Anfangspunkt für Verkettungen von Handlungen und Ereignissen, die sich als verhängnisvoll oder auch als überraschend hilfreich erweisen können.
Auf Anhieb haben die Maßnahmen des sozialen Abstands und der Reduktion von kritischen Kontaktmöglichkeiten die meisten Menschen in Europa, aber auch zum Beispiel in Taiwan oder Senegal, so weit überzeugt, dass sie mit Erfolg umgesetzt werden konnten. Ihr erheblicher Nutzen wurde messbar. Sichtbar wird auch, dass nur eine freiheitliche Ordnung auf diejenige freie Kooperation von Bürgerinnen und Bürgern zählen kann, die überwiegend auf dem Vertrauen in Maßnahmen der Behörden basiert. Gefahren für Gesundheit und Leben, vor denen die Einzelnen sich nicht durch individuelles Handeln schützen können, sind selbst für liberale Anarchisten eine klassische Aufgabe für den Minimalstaat, sie rechtfertigen geradezu sein Bestehen. Ein Staat, der Ansteckungsvermeidung durchsetzt, ist nicht nur nicht tyrannisch, es zeigt sich überdies: Tyrannische Staaten und rechtsextrem-wirtschaftsliberale Regierungen sind zu dieser Durchsetzung gar nicht in der Lage, weil sie keine klare Linie fassen können und niemand auf sie hört. Wer bei uns den Konformitätszwang von Notstandspolitik oder außerordentlicher Lage kritisiert, hat es nicht primär mit der Regierung, er hat es mit der Mehrheit der Bevölkerung zu tun. Mit dem Andauern der Maßnahmen werden allerdings die Lasten merklicher und steigt der Begründungsdruck. Angesichts der Einsicht, dass tatsächlich nur die Ansteckungsvermeidung ein exponentielles Wüten der Pandemie aufhalten konnte, sind wir auf die ursprüngliche erklärte Zweckbestimmung der Maßnahmen, nämlich den Aufschub, zurückgeworfen. Was man aufgeschoben hat, erwartet einen weiterhin. Das Virus ist nicht verschwunden oder zum Haustier geworden und eine medizinische Bewältigung im großen Stil ungewiss.
Performativer Widerspruch
Das Unbehagen mit dem Syndrom ‹Pandemie›, das nicht nur ein Virus und die von ihm ausgelösten Erkrankungen, sondern auch die Anfälligkeit unserer Lebensform und das Ensemble der Maßnahmen umfasst, mit dem im globalen Maßstab darauf reagiert wird, hat aber noch andere und vielleicht tiefer reichende Gründe. Mit dem Sars-2-Coronavirus spitzt sich eine Entwicklung zu, die sich in den hoch technisierten Ländern, in ihrer Medizin, Pädagogik, Daseinsvorsorge, in ihren Wissensbeständen schon lange anbahnt. Technisches Vorgehen besteht nicht nur aus einem Set von Geräten und der Fertigkeit, diese weiterzuentwickeln, sondern in einer Art und Weise, die Welt auf Probleme hin zu befragen beziehungsweise sich von ihr Probleme vorlegen zu lassen, und diese Probleme dann zu lösen. Die Form der Problemerkennung und -lösung, die sich ausgebreitet hat, lässt sich auf einen Nenner bringen: Konkrete Erfahrungen werden durch statistische Evidenz bewährt oder verworfen, überformt und letztlich vollständig entwertet und ersetzt. Sie werden als anekdotisch aussortiert und damit einer Sprache beraubt, die zu Praktiken der Wissensgewinnung Verbindung hätte. Sachkunde ebenso wie konkrete, soziale und individuelle Erfahrungen finden lediglich ein prekäres Asyl im Schonraum der literarischen oder filmischen Narrativität, im Storytelling, in trivialen psychologischen Befunden oder in Subkulturen, denen ihre Abschottung vom Raum der wissenschaftlichen Überprüfung ihrerseits zum Verhängnis wird. Die Juridifizierung, das Bestehen auf Freiheitsrechten, wird zur letzten Zuflucht eines Erfahrungsvermögens, ohne das jede andere wahrheitsfähige Verbindung zur Welt nichtig wäre.

Eine Wissenschaftsauffassung, die sich darauf beschränkt, der wissenschaftlichen Perspektive in Hinblick auf unsere Grundrechte eine Grenze zu ziehen, besiegelt einen Zustand, in dem wir zwar mit zwei Augen sehen, aber die beiden Bilder nicht mehr zu einem kohärenten Bild der Welt fusionieren können. So kommt es zu dem performativen Widerspruch, dass einerseits den ‹Risikogruppen› empfohlen wird, für sich selbst zu sorgen, sobald wir uns im Raum der Politik und nicht mehr der Wissenschaft befinden, aber dafür andererseits eben der Begriff der ‹Risikogruppe› unkritisch bemüht wird, zu dem wir nur auf dem Weg über Statistiken kommen, Statistiken, die zunächst selbst nichts als mathematisch stilisierte Momentaufnahmen im unabgeschlossenen Pandemiegeschehen sind. Vielleicht ist die Trennung verschiedener Geltungsmodi und normativer Ansprüche unvermeidlich, aber dann sollten wir genauer wissen, wie wir sie vornehmen und was wir damit tun. Ich werde mich deshalb im Folgenden nicht an der Diskussion unter Zeitungsleserinnen und -lesern beteiligen über beliebig aufgegriffene Statistiken, für deren Interpretation man eigentlich Fachwissen benötigt. Mir geht es um ein grundlegenderes Problem.
Die übersinnliche Welt der Statistik
Mit der Ausschaltung konkreter Erfahrung wird eine auf den ersten Blick offenkundig überlegene wissenschaftliche Wertigkeit von Aussagen gewonnen. Den Maßnahmen, die fast alle menschlichen Staaten auf diesem Planeten gegen die Pandemie ergriffen haben, kommt man nicht dadurch bei, dass man sie auf Repression, autoritäre Strukturen oder unmusisches Interesse an Planbarkeit zurückführt. Wer so argumentiert, denkt (oder denkt eben nicht) wie der indische Herrscher, der nach einer arabischen Legende dem Erfinder des Schachspiels, einem Brahmanen, einen Wunsch gewährt, den er für harmlos hält. Der Brahmane wünscht sich Weizenkörner auf dem Schachbrett, eins auf dem ersten Feld, zwei auf dem zweiten, vier auf dem dritten, acht auf dem vierten und so weiter. Das hört sich nach wenig an, aber die Mathematiker des unvorsichtigen Herrschers müssen feststellen, dass die resultierende Gesamtzahl über 18 Trillionen Körner beträgt, das wäre das über Tausendfache einer heutigen weltweiten Weizenernte. Wenn man, um auf die Pandemie zurückzukommen, nach zwei Wochen festgestellt hat, dass sich die Infektionszahlen in einem Gebiet alle zwei oder drei Tage verdoppeln, kann man ausrechnen, wie viele Leute von der Infektion in kürzester Zeit erfasst werden und welche schwindelerregenden Zahlen an Toten sich selbst dann ergeben, wenn die weitaus meisten die Ansteckung überleben und irgendwann später eine Sättigung mit dem Virus eintritt, die die Ansteckungswahrscheinlichkeit verringert. Die Zahlen, die aus dem sogenannten exponentiellen Wachstum resultieren, sprengen unser Vorstellungsvermögen, aber nicht das Rechenvermögen, das schon die indischen Mathematiker der arabischen Legende besaßen. Gegen das Rechnen hilft es nichts, sich zu erzählen, dass Menschen etwas anderes sind als Herdentiere oder Weizenkörner. Man kann diese Darstellung der Realität verfeinern und Faktoren ausfindig machen, die ihre Geltung für Prognosen einschränken, und es bleibt dabei genug Raum für Improvisation und Lernprozesse. Aber die mathematische Autorität dieser Darstellung kritisieren und mit ihr verhandeln wie mit Eltern oder Polizisten oder Regierungen kann man nicht. Das Problem der Statistik ist nicht, wie viele glauben, dass man sie fälschen und manipulieren kann. Das Problem ist im Gegenteil die Macht, die sie hat, wenn sie korrekt gehandhabt und nach den Regeln der Kunst interpretiert wird.
Das Problem der Statistik ist nicht, wie viele glauben, dass man sie fälschen und manipulieren kann. Das Problem ist im Gegenteil die Macht, die sie hat, wenn sie korrekt gehandhabt und nach den Regeln der Kunst interpretiert wird.
Die heutige Wissenschaft hat komplette Dispositive ausgebildet, um den Einblick, den Menschen in die übersinnliche Welt der Zahlen haben, bestmöglich zu nutzen. Nicht Traditionen, Interessen, Gefühle, Intuitionen, sondern replizierbare Experimente, nachvollziehbare Modellierungen, objektive Datenreihen resultieren in den wissenschaftlichen Ergebnissen, aufgrund derer belastbare Prognosen und einigermaßen sichere Steuerung möglich sind. Für die vollständige Ersetzung von Sachkontakt und subjektiver Erfahrung ist aber ein beträchtlicher Preis zu entrichten: Sie bedeutet letztlich eine Entkernung des Selbstwertgefühls und der Urteils- und Handlungskraft eben der konkreten Menschen, um derentwillen Wissenschaft betrieben wird. Das Dilemma, sich zwischen der zwingenden Evidenz statistischer Aussagen und der Evidenz unvertretbar eigener Erfahrung entscheiden zu sollen, nötigt diejenigen, die sich ihm ausgesetzt sehen, in eine inkongruente Wahrnehmung und in eine Aufspaltung des Denkens. Schwer Erkrankte kennen die Zumutung, sich nach einer Statistik richten zu müssen, die die eigenen Heilungschancen beziffert, aber zugleich die Antwort auf die Frage, wo mein je eigener Platz in der Statistik ist, hinter einem Schleier des Nichtwissens verbirgt. Aufgeklärte Medizin kompensiert das, indem sie die Zustimmung der Patientinnen und Patienten einholt und ihnen letzte Gefühlsentscheidungen in der Wahl der Behandlung einräumt und zugleich aufbürdet. Damit ist deren Grund- respektive Patientenrechten Genüge getan. Mit einer ähnlichen Zumutung machen nun im universellen Maßstab ganze Bevölkerungen Bekanntschaft. Obwohl meine Chance, mich anzustecken, verschwindend gering ist, bin ich aufgerufen, an dem statistischen und altruistischen Gesamtkunstwerk mitzuwirken, das dann im günstigen Fall tatsächlich damit einhergeht, dass wie von Zauberhand Ansteckungsraten sinken und weniger Leute als erkrankt auffallen.
Ein wirres Durcheinander
Offenbar sind genug Menschen zunächst einmal (jedenfalls bei uns) in dieses Denken so weit eingeübt, dass sie sich auf den Standpunkt der Statistik zu erheben bereit sind. Ein am Nutzen von Regeln und Gesetzen ausgerichteter Utilitarismus höherer Ordnung disponiert Menschen dazu, eine schnelle und ordentliche Befolgung von Anweisungen im Notfall einer langwierigen Prüfung und Aushandlung ihres Inhalts vorzuziehen. Hinzu kommt die Faszination durch eine neuartige Wissenschaftskommunikation, die die Chance wahrnimmt, viele Menschen an die esoterische mathematische Denkweise heranzuführen. Das haben Rundfunk-Podcasts deutscher Virologen und Epidemiologen eindrücklich vermocht. Der mexikanische Unterstaatssekretär für Gesundheitsfragen, Hugo López Gatell, wurde in einer der ersten Pressekonferenzen seiner Regierung zum Thema gefragt, ob diese Regierung in all den Kurven und Diagrammen nicht der Öffentlichkeit Informationen vorenthalte. Seine Antwort lautete, er sei fasziniert, dass man sich für die Daten interessiere, die Zeit für die Pressekonferenz sei begrenzt, er könne aber gerne bleiben und das weiter erklären. So ging der Anlass in eine Statistiknachhilfestunde für die Pressevertreter und -vertreterinnen über.
Die Modelle der Wissenschaft und die Maßnahmen der Regierungen besetzen einen imaginären Raum, in dem Probleme durch Forschung und Entscheidung unter Mitwirkung der Betroffenen bzw. ihrer legitimierten Vertreter und Vertreterinnen einer Lösung zugeführt werden können. Daneben macht sich aber eine Wirklichkeit bemerkbar, in der man mit diesen Lösungen selbst wieder leben muss. Diese Erfahrungen sind aus der Sicht der Statistik anekdotische: Es sind Einzelfälle, aus denen sich nichts lernen lässt. Die einen kennen einfach niemanden, der die Krankheit hat, und fangen an, an ihrer Realität zu zweifeln. Genauso bemerkenswert ist das andere Phänomen: Man kennt genug Leute, die, teilweise schon sehr früh, aber unauffällig, erkrankt sind, und fragt sich, welche Rolle sie eigentlich in einer Statistik spielen, die ihre Fallzahlen aus dem Aufkommen in den Krankenhäusern und aus Testserien gewinnt. Wer nicht vom Scheinwerferlicht der Institutionen erfasst wurde, darf im Alltag keineswegs sicher sein, die Krankheit durchgemacht zu haben und gegen sie einstweilen gefeit zu sein, auch wenn alle Indizien dafür sprechen. Wissenschaft geht dabei in das über, was Foucault einen humanwissenschaftlichen Diskurs genannt hat. Wir haben es nicht mehr mit fallibler und korrekturbereiter Forschung in Bewegung und auch nicht mit angereicherter Lebenserfahrung zu tun, sondern häufig mit geronnenen Partikeln einer skeptischen Ideologie, die den Meinungshorizont der Zeitungsleserinnen, der Fernseh- und Internetkonsumenten bestimmt. In dieser Lebenswelt dominiert der Eindruck, die Wissenschaft, deren Erkenntnistiefe und Lernbereitschaft in einer erdumspannenden Kommunikation gerade in dieser Pandemie als beispiellos imponiert, biete das Bild eines wirren Durcheinanders, in dem sich widersprüchliche und folglich haltlose Behauptungen über angebliche Fakten in großem Tempo ablösen. Oft bedient sich diese Skepsis dabei zugleich noch umstandslos und inkonsequent bei dem Ausschnitt aus der angezweifelten Wissenschaft, der ihr gerade in den Blick gerät.
Das Dilemma, sich zwischen der zwingenden Evidenz statistischer Aussagen und der Evidenz unvertretbar eigener Erfahrung entscheiden zu sollen, nötigt diejenigen, die sich ihm ausgesetzt sehen, in eine inkongruente Wahrnehmung und in eine Aufspaltung des Denkens.
Noch weniger Chancen, sich gegen die gerade verfügbare Statistik und deren kommunikative Verfestigung und populäre Bezweiflung zu behaupten, hat die individuelle Erfahrung, wenn es um die medizinische Behandlung der Krankheit geht. Im Dunkel der Dunkelziffer greifen Menschen auf eine hausärztliche und oft auch komplementärmedizinische Versorgung zurück, die dem Spuk in einem frühen Stadium ein Ende setzen kann, weil in diesem Fall die ärztliche Erfahrung unter Umständen weiter reicht und früher da ist als die Studien, die sie bestätigen könnten, und als das Wissen um kausale Zusammenhänge. Angesichts solcher Fälle fragt man sich, welche Verzerrung eigentlich den Daten zugrunde liegt, die nur diejenigen abbilden, die sich nicht anders zu helfen wissen, als ihr Heil zu spät und in den Behandlungsmöglichkeiten der schulmedizinischen Spitäler zu suchen. Vielen kann dort zwar geholfen werden, aber andere wurden zum Opfer einer hilflosen und schematischen Versorgung, die erst allmählich, auf dem Umweg über Studien, korrigiert werden konnte.

Für das zukünftige Zusammenleben mit dem Virus liegt die Frage nahe, welche Handlungsmöglichkeiten sich eröffnen würden, wäre nicht der Rückfluss aus den nicht studienförmig vorschematisierten Erfahrungen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und deren Patientinnen und Patienten in den Bereich der als seriös anerkannten Forschung in den letzten Jahrzehnten weitgehend ausgeschaltet worden. Man ist versucht, sich auszumalen, wie die Entscheidungsgrundlagen für die Politik aussähen, wenn die veröffentlichte und politisch beachtete Forschung mehr sagen könnte darüber, was Hausärztinnen und Praktiker der fortgeschrittenen Komplementärmedizin tun, bevor Patienten und Patientinnen im Krankenhaus oder bei den Gesundheitsämtern erscheinen, oder vielmehr wenn sie gar nicht erst erscheinen müssen. Eine Nebenwirkung dieser Stilisierung von Evidenz war die anfangs mitunter krasse Fehleinschätzung der Resilienz und des Handlungsspielraums der Länder des Südens, insbesondere Indiens und Afrikas, deren Diversität ebenso ignoriert wird wie der Vorteil von pragmatischeren Formen der Wissensgewinnung.
Eine Lehre der Pandemie
In einer Pandemie gilt für viele sonst nicht im Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit stehende Personen, dass sie, neben Frauen und Kleinkindern etwa auch Wanderarbeiter und Schlachthauspersonal, das Virus genauso verbreiten können wie Konferenzteilnehmende, Clubbesucher, Hochzeitsgäste oder Geschäftsreisende. Was die Beteiligung am Infektionsgeschehen betrifft, ist das Virus zunächst ein Gleichmacher, wenn er auch nicht alle gleich hart trifft. Das Virus ist Materialist, es konfrontiert auf unangenehme, aber lehrreiche Weise mit den grundlegenden Bedingungen einer inkarnierten Existenz, in der niemand einem anderen Menschen etwas voraus hat, auch wenn manche ihre Individualität gerne beweisen würden, indem sie bei der Maskenpflicht eine Ausnahme beanspruchen. Aber das Virus ist kein Reduktionist. Darüber, dass es lebt, mutiert, unabsehbar in Bewegung ist, muss die virologische Forschung nicht belehrt werden, das zu beobachten, ist ihr täglich Brot. So lebendig wie das Virus ist die menschliche Auseinandersetzung mit ihm. Die Aufmerksamkeit für Lebensformen, Praktiken und Wissen, wenn es um die Bewältigung der Krankheit geht, ist aber nach wie vor ungleich verteilt, diese Ungleichheit spitzt sich sogar noch zu.
Die statistisch gesteuerten Systeme lernen in einem hohen Tempo und können ihren Beobachtungsmodus scheinbar beliebig verfeinern, aber sie leben von Voraussetzungen, die sie nicht erfassen können. Im Raum der Dunkelziffern gibt es nicht nur Virusträgerinnen und -spreader, sondern auch Mut, Erfahrung und Selbständigkeit von handelnden und leidenden Menschen, die die unaufhebbaren Unschärfen und systematischen Fehleinschätzungen der Systeme kompensieren, und zwar nicht erst dann, wenn dieses Verhalten in Datenreihen und Richtlinien (oder in politischen Protesten) dargestellt und sanktioniert wird, sondern rechtzeitig, dann, wenn die Situation es fordert und Erfahrung es erlaubt. Diese Lebensformen verdienen, auf angemessene Weise beachtet, geschützt und weitergegeben zu werden. Eine solche Forderung lässt sich nicht auf die nach Grund- und Freiheitsrechten herunterbrechen. Zu dieser Angemessenheit gehört ein Umgang mit Statistik, bei der diese zutage fördert, was wir wissen wollen, ohne das Wissbare auf das statistisch Erfassbare einzuschränken oder vorläufige Resultate als Herrschafts- und Exklusionswissen zu missbrauchen. Auch das ist eine Lehre, die sich aus der Pandemie ziehen lässt.











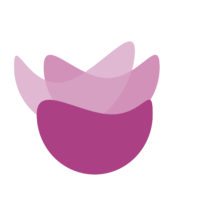
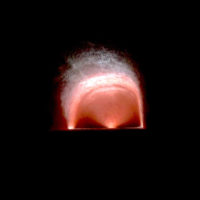

Sehr geehrte Frau Hilmer,
Vielen Dank für Ihren Artikel.
In einem Punkt muss ich Ihnen aber unbedingt widersprechen :
Bevor ich mir mein Denken aufspalten lasse und in einer für mich nicht tolerierbaren kognitiven Dissonanz verbleiben würde , wäre ich immer ( und habe das auch in der vorliegenden Krise getan ) weiterhin daran interessiert mich solange mit allen Aspekten zu beschäftigen bis mein eigenes Wahrnehmen und die zwingende Evidenz der statistischen Aussagen in Übereinstimmung zu bringen sind !
Sonst habe ich was übersehen oder falsch interpretiert .
Danach bin ich dann auch im Reinen mit mir selber und habe keinen „Knoten im Hirn“
Alles Beste Ihnen und viel Freude weiterhin beim Denken
Martina Heller -Krug
(Mutter von 4Söhnen, Großmutter von 6Enkelkindern soweit)
Das Problem ist die Auswertung der Statistiken: Infektionen sind nicht gleichzusetzen mit Erkrankten. Positiv Getestete sind nicht unbedingt krank. Zu viele Menschen zu testen erhöht selbstverständlich die Infizierten, aber es erhöht nicht die tatsächlich Erkrankten und Verbreiter dieses Virus. Das wird aber alles in einen Topf geworfen.
Hat der Redakteur das Artikel richtig gelesen? Es kommt mir vor, er schreibt etwas ganz Anderes.
=
“Sie bedeutet letztlich eine Entkernung des Selbstwertgefühls und der Urteils- und Handlungskraft eben der konkreten Menschen, um derentwillen Wissenschaft betrieben wird.”
Ich glaube nicht daß mein Selbstwert ruht auf mein Urteilskraft über ein unsichtbares Virus. Weder über asymptomatische Infiziertheit oder Infizierbarheit.
Ein Niederländischer Psychologe sagte daß jeder denkt daß die Statistik nicht ihm gilt. Also von zwingender Evidenz ist wenigstens in Holland keine Rede.