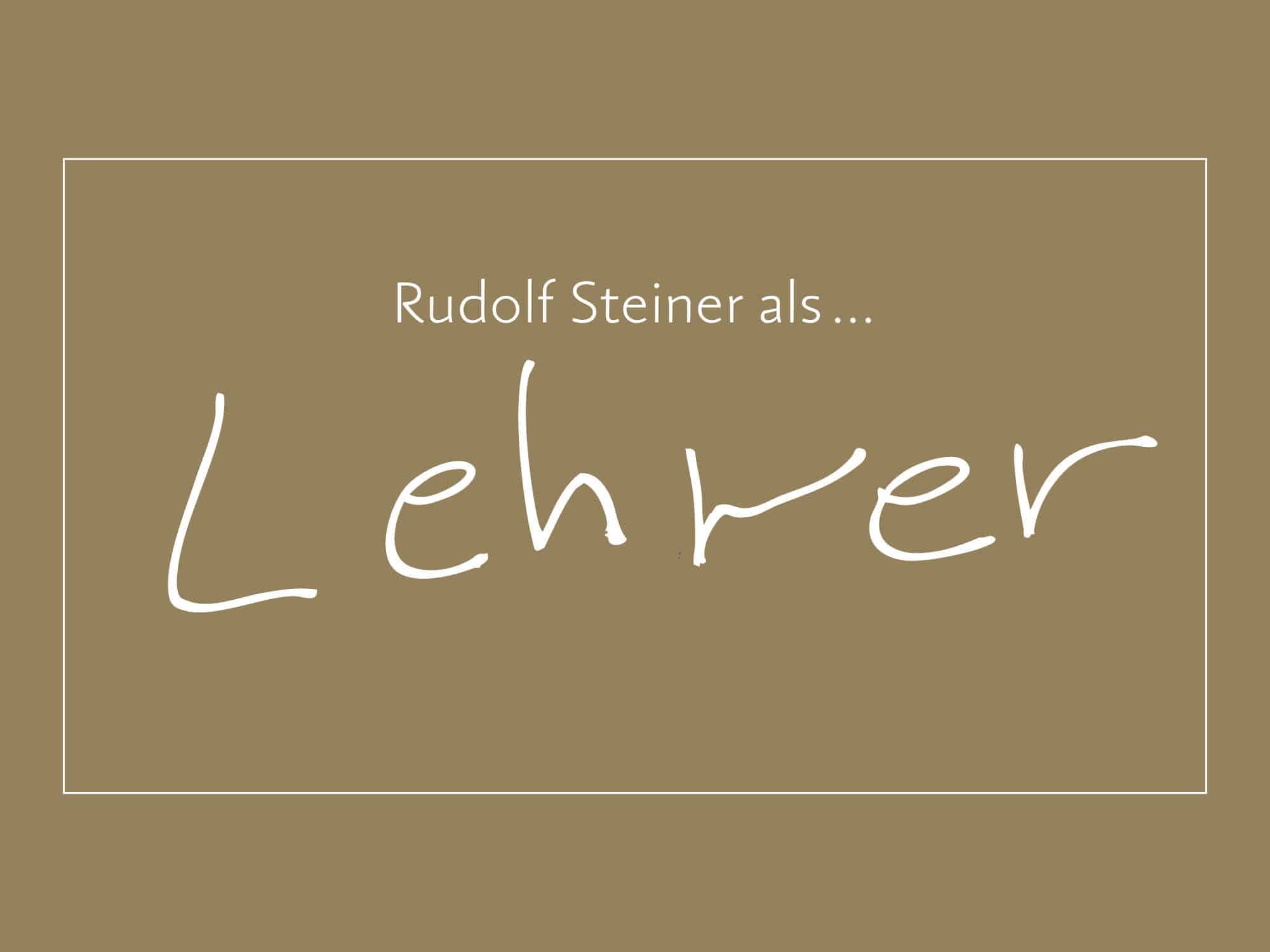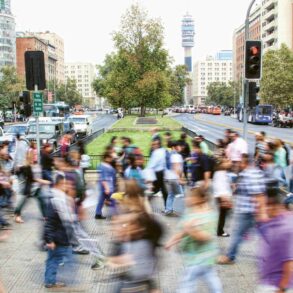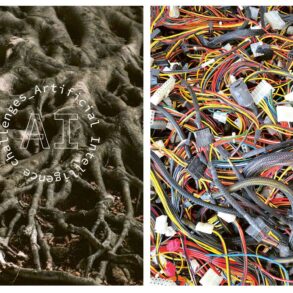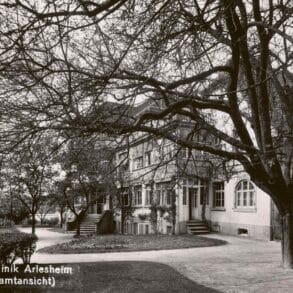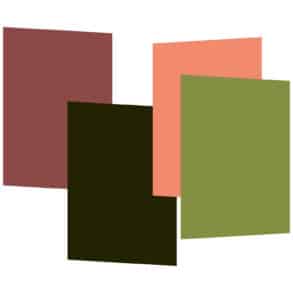Mit der Herausforderung, das Mysterienwort in die Öffentlichkeit zu tragen, brachte Rudolf Steiner ins bewusste Leben, dass sich Wirklichkeit nicht endgültig festlegen lässt.
Als ich Kunststudent war, nahm ich an einem Projekt teil, bei dem wir, meine zukünftige Frau und ich, vierzig Kinder der vierten Klasse in einer unterprivilegierten Stadt im Malen unterrichten sollten. Dafür wurden unsere Studienkosten von einer Stiftung übernommen. Es gab kein Museum in der Gegend, und die Kinder hatten in ihrem Leben noch nie ein Museum besucht oder ein Kunstwerk gesehen. Ihre Erfahrungen mit Bildern stammten aus dem Fernsehen. Das einzige Material, mit dem sie etwas ausprobiert hatten, waren die Wachsmalstifte im Kindergarten. Und das waren auch die Materialien, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Wir selbst standen mitten im Studium, wir waren erfüllt von Kunst und anthroposophischen Idealen.
Als ich gebeten wurde, diesen Text zu schreiben, und begann, über Rudolf Steiners Aufgaben als Lehrer nachzudenken – er sollte über die geistige Realität in Mitteleuropa am Anfang des 20. Jahrhunderts sprechen –, kam mir diese Erinnerung in den Sinn.
Es gab keine Zeit in der Weltgeschichte und keine aufkommende Kultur, in der die Menschen so weit von der konkreten geistigen Erfahrung oder dem Wissen entfernt waren wie am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Steiner stand also vor einer Aufgabe, die man so beschreiben kann: Wie kann ich etwas unterrichten, in einer Kultur, in der es weder eine Erfahrung noch eine Sprache gibt, die damit zu verbinden ist?
Die deutsche Sprache, in die die weise Führung der Menschheit Rudolf Steiner hineinversetzt hat, war zwar biegsam und modellierbar, aber eher geeignet, Systeme herzustellen. Es war die Zeit nach den großen philosophischen Systemen, die noch nachklangen, um Raum für eine Bürokratie des Geistes zu schaffen. Der Intellektualismus, das gedankliche Missbrauchen von Begriffen, die ihren Kontakt zur Wirklichkeit aufgegeben hatten, war auf seinem Höhepunkt. Als Antwort versuchte die theosophische Bewegung, die Leere durch indische Begriffe, die dem westlichen Denken unzugänglich blieben, und einen großen Haufen sentimentalen Aberglaubens zu füllen. Nietzsche, der gegen seine Zeit kämpfte, geriet in Umnachtung. Die Schattenblumen des Nationalbewusstseins blühten dunkel überall, sodass die einzigen Streiter des Lichts in der Arbeiterbewegung zu finden waren. Die aber …, ja wir wissen, wo es mit der Russischen Revolution endete. Die Berufung, das Mysterienwort an die Öffentlichkeit zu tragen, ohne es zu verraten, hätte nicht hoffnungsloser erscheinen können.
Die Antwort Rudolf Steiners auf die Situation, seine moralische Fantasie, ist spektakulär. Er versucht, einen Weg zu bahnen, der aus den Abstraktionen des deutschen Idealismus in die Realität führt und zugleich durch den bildhaften Sensualismus von Goethes Dichtung und Wissenschaft das Geistige zurück in die wahrnehmbare Welt führt. Es war kein Masterplan, sondern eine Reihe von moralischen Intuitionen, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten, um eine Lehre hervorzubringen, die zugleich Sprache und Praxis ist.
Als großer Lehrer in Denken, Tat und Wort ist sein Werk alles, was die akademisierte deutschsprachige und mitteleuropäische Kultur nicht war und nicht ist. Es ist der Ansatz einer Gegenkultur, die sich der Avantgarde anschloss und das Bürgertum fernhalten sollte. Es ist unsystematisch und lässt sich nicht auf ein System oder eine Methode reduzieren. (Es gibt sogar keine ‹goetheanistische Methode›. Wie wir bei Goethe selbst lesen können, wird die Methode durch den beobachteten Gegenstand immer wieder neu bestimmt). Es vermeidet Definitionen, weil sich die Wirklichkeit nicht finalisieren lässt. Es stellt keine Thesen oder Hypothesen auf, weil es das Denken in die Sachen versetzt und das Erkennen immer der Wahrnehmung folgen lässt. Es ist eine empirische Wissenschaft des Unsichtbaren, also ein paradoxes Unternehmen, das als Ergebnis nicht auf einen Haufen Bücher, Theorien und Wissen abzielt, sondern auf praktische Arbeit und eine neue Sprache, durch die das Geistige überhaupt erst nachgedacht werden kann.
«Derjenige, der wirklich Seherisches auszudrücken hat, muß in Widersprüchen wirken […]»1, sagte er in seinen Kunstvorträgen. Es ist der einzige Weg, das Ungreifbare hervorzurufen. Als Lehrer, in geschriebenen Texten oder mündlich, zieht er es vor, in Bildern zu sprechen, in Bildern, die nicht das sind, was er meint, aber dieses als Nachklang hervorrufen. Seine Begriffe sind wie Kreise im Sand, sie umreißen für einen Moment, um mit den nächsten Wellen verformt, geöffnet oder sogar gelöscht zu werden. Es gibt in seiner Lehrtätigkeit keinen Platz für Abstraktionen. Was abstrakt erscheinen kann, sind nur die Grenzen unserer eigenen Fantasiefähigkeit. Als Studierende verstehen wir ihn nur, wenn wir bildend, musizierend, dichtend denken. Die Begriffe sind nur wie Griffe an einer Kletterwand, wir lassen sie hinter uns, wenn wir vorankommen. Die Klarheit des Denkens entwickelt sich, wenn das Gedachte sich aus der Sprache, aus den Worten und ihrer limitierenden momentanen Bedeutung erhebt. Das Erkennen ringt sich von der Sprache frei. Es ist ein Unterricht, der sich in anderen Zeiten als Dichtung oder vielleicht Skulptur ausgedrückt hätte. Es ist ungezähmt, großzügig, eher wie das, was ich vom Donner eines Sturms lernen kann, als das, was ich an der Universität lernen kann.
Als Lehrer ist Rudolf Steiner unverschämt. Er schmeichelt nie, er zähmt die Pferde des Denkens, lässt sie in unendlichen Kreisen vor uns reiten, ist selbst aber völlig immun und gleichgültig gegenüber Popularität. In einer unbiegsamen michaelischen Geste weigert er sich, herabzusteigen, er spricht klar, in der Sprache des Gegenübers, aber es erfordert den Willen des Studierenden, bildend in das Gesprochene einzusteigen. Als Information taugt seine Lehre nichts, sie macht nur Sinn, wenn sie errungen und durchforscht wird, oder in den Worten eines seiner geistigen Vorfahren, Johann Gottlieb Fichte: «Ich […] will mit diesem Worte als ein Verstummter und Verschwundener betrachtet sein, und Sie selbst müssen nun an meine Stelle treten. Alles, was von nun an in dieser Versammlung gedacht werden soll, sei gedacht und sei wahr, nur inwiefern Sie selbst es gedacht und als wahr eingesehen haben.»2
Steiner ist der Lehrer eines Anfangs. Er hämmert an einer Kultur, die er zwar versteht, der er sich aber widersetzen muss. Es gibt für ihn keine ‹guten alten Werte›. Darin ist er Nietzsche nah. Es gibt auch keine Grenze zum Erkennen, keine moralisierenden Vorschriften, keinen Grund, an einer Kultur teilzunehmen, an der wir nicht teilnehmen wollen. Als Lehrer wollte Steiner nie akzeptiert werden. Er suchte nicht seinen Platz an der Uni, im Museum oder in der Akademie. Er ist ein Durchbrecher, ein kompromissloser Wegweiser, der sich bis ans Ende der Welt traut, um am Weltenozean sich vollzutrinken und die Midgardschlange von Angesicht zu schauen. Rudolf Steiner ist ein Kämpferlehrer gewesen, und als solcher wird er bleiben, ein Sohn seiner Zeit, also Lichtjahre seiner Zeit voraus.
Mit ‹Rudolf Steiner als …› überschreiben wir eine Reihe von Artikeln zum 100. Todesjahr Rudolf Steiners.
Fußnoten
- Rudolf Steiner, Vortrag ‹Das Sinnlich-Übersinnliche – Geistige Erkenntnis und Künstlerisches Schaffen›, Wien, 1. Juni 1918, in: Rudolf Steiner, Kunst und Kunsterkenntnis, Grundlagen einer neuen Ästhetik. GA 271, Dornach 1985.
- Johann Gottlieb Fichte, Wissenschaftslehre, vorgetragen im Jahr 1804, aus Immanuel Hermann Fichte (Hrsg.), Nachgelassene Werke von Johann Gottlieb Fichte, zweiter Band, Verlag Werner & Müller, Leipzig 1834.