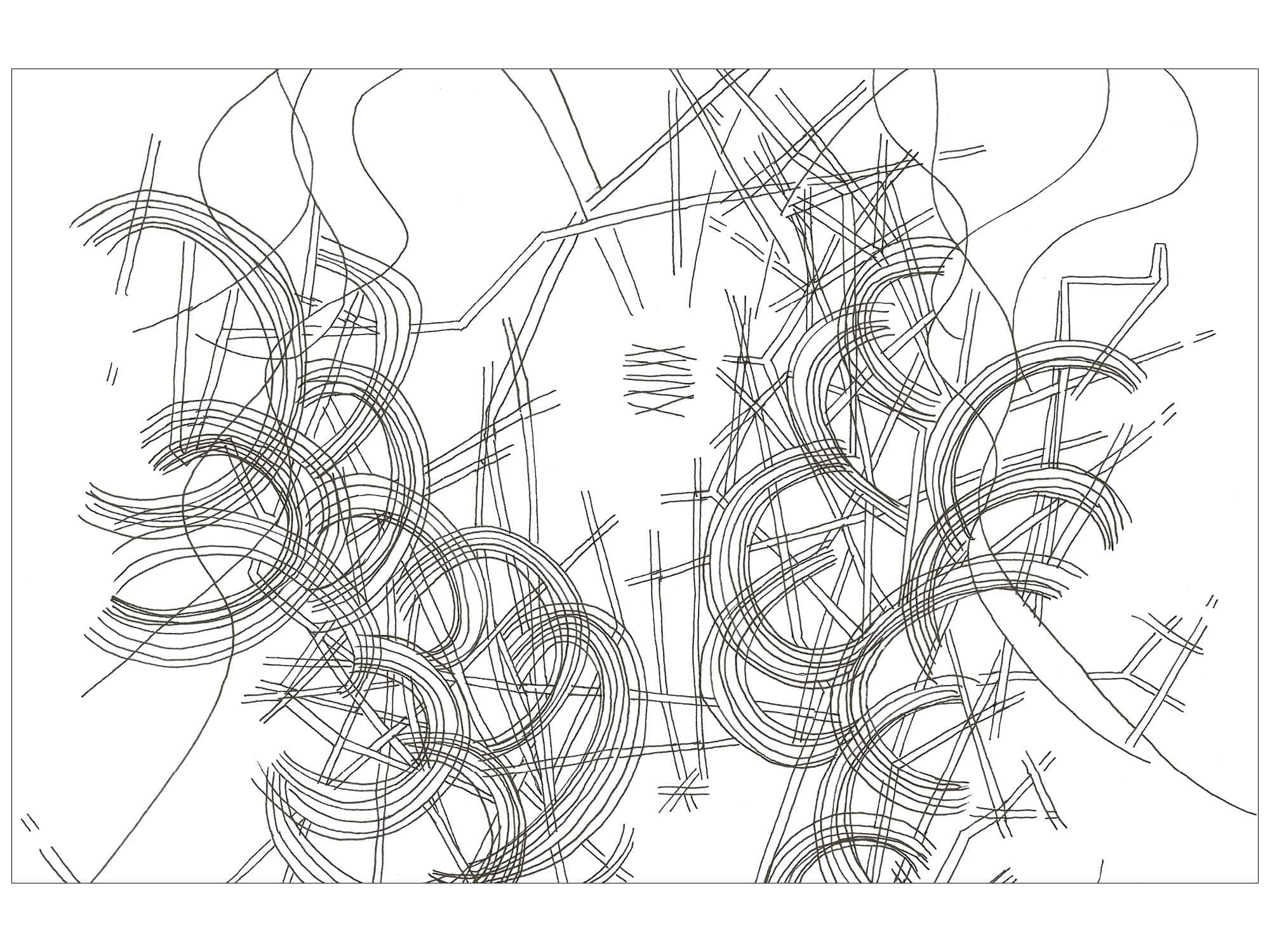Das Feminine sprengt Rollen und weist auf das Potenzial des Möglichen selbst. In ihm wird Verschiedenheit zur schöpferischen Kraft. Zart webt es um unser Anderssein. Wo das Feminine willkommen geheißen wird, entsteht Resonanz – ein neuer Eigenton, der verbindet, statt zu ordnen.
Die Befreiung des Weiblichen als Fähigkeit, die nur Frauen zugewiesen wird, hat erst begonnen. Es geht dabei nicht um eine Befreiung dieser Fähigkeiten, sondern um die Befreiung der Fremdbestimmung, die angesichts dieser ‹weiblichen› Qualitäten noch immer eine Rolle spielt. Das gilt auch für die Qualitäten, die einem Mann zugeordnet werden können. Denn noch immer teilen Frau und Mann einen gemeinsamen religiös-soziologisch-kulturellen Umkreis, durch den verschiedene Arten von Fremdbestimmung auf beide einwirken, selbst bis in die Sprache hinein. Noch immer werden ‹weiblich› und ‹männlich› durchaus als Adjektive verwendet. Als Substantiv genutzt, zum Beispiel ‹das Weibliche›, entziehen wir sie schon ein wenig der Fremdbestimmung. Sowohl das Weibliche als auch das Männliche werden dann zu eigenständigen Seinsqualitäten, die im Menschlichen schlechthin ihre Urquelle haben. Der Ausdruck ‹das Feminine› findet im Weiblichen eine Grundlage, ist aber nicht zwingend identisch damit. Beim ‹Femininen› geht es um eine radikal neue Qualität, an der sowohl Männer als Frauen teilhaben. Es meint jedoch nicht das wechselseitige Übernehmen einer ‹Rolle›. Das ‹Weibliche› als Qualität lässt sich weder ergänzen noch ersetzen vom ‹Männlichen› als Qualität und umgekehrt. Jede Rolle trägt in sich noch immer die Spuren einer möglichen Fremdbestimmung. Man kann sich gar selbst eine Rolle auferlegen. Auch das kann Fremdbestimmung sein. Es kommt jedoch darauf an, dass das ‹Weibliche› und das ‹Männliche› ihre selbst auferlegten Rollen erweitern, dass sie aufgrund ihrer Qualität, einander Gegensatz zu sein, eine dritte Qualität entwickeln. Diese eröffnet eine neue Ebene. In ihr steht die Eigenständigkeit am Anfang und Freiheit kann mitatmen.
Das ‹Feminine› erscheint mir als dieser Neubeginn. Es scheint durch die unterschiedlichen Qualitäten hindurch und verleiht diesen einen Glanz. Ähnlich wie das Licht, das durch die Finsternis der Fremdbestimmung hindurchgegangen ist und jetzt auf einer neuen Ebene den beiden einen einheitlichen Glanz der Schönheit als schöpferisches Vermögen verleiht. Bodo von Plato redet hier von einer neuen Ästhetik aus einer Verbindung der Gegensätze als eine dritten Qualität.1 Heute kündigt sich die Befreiung von der Fremdbestimmung einer Gegensätzlichkeit an, die Geschlecht und Gender als einzige Grundlage einer Rolle versteht oder deutet.

Eine kleine Vorgeschichte
1963 wurde ‹The Feminine Mystique› (dt. ‹Der Weiblichkeitswahn›) der amerikanischen Schriftstellerin und Journalistin Betty Friedan veröffentlicht. Im Rückblick entzündete das Buch eine zweite Welle der sogenannten feministischen Bewegung. Die Frau war in den 1950/60er-Jahren zum Objekt einer gezielten Mystifikation geworden, wobei ihr Eigenschaften zugeschrieben und von ihr erwartet wurden, die sie nicht selbst bestimmen konnte. Die Zeit der Eigeninitiative der Frau, die sie kurze Zeit während der Kriegsjahre hatte ausüben können, war vorbei. Teil der Mystifikation war auch, dass die Rolle, die ihr als Frau zugesprochen wurde, sie glücklich machen könnte bzw. sollte. Das an Geschlecht und Gender streng gebundene ‹Weibliche› wurde zum Konsumgut und ließ sich wunderbar vermarkten. Rätselhaft bleibt aber das Wort ‹feminine› im Titel. Daraus entstanden Slogans wie ‹The future will be feminine› (dt. ‹Die Zukunft ist weiblich›). Es begann eine äußerst wichtige Sensibilisierung.
Was ändert sich, wenn Qualitäten, die traditionell der Frau aus einem kulturellen und sozialen Umkreis zugeordnet werden, heute eigenständig, aus sich heraus, entwickelt werden können? Das wäre wie ein Ausüben dieser vorhandenen Eigenschaften, aber nun aus der innewohnenden Intention, das Vorgegebene mit dem Hauch eines Neuen glänzen zu lassen. Das wäre der Schritt vom Adjektiv zum Substantiv! Das wäre die Stunde des Femininen. Dann tritt nämlich das Feminine als eine neue Qualität ein und auf, und resoniert. Neu ist es auch, weil es die bereits vorhandenen weiblichen und männlichen Eigenschaften potenziert. Eigenschaften werden dann zu schaffendem Vermögen. Ein Vermögen, das als ein Einheitliches wirksam wird, weil es die vorhandene Verschiedenartigkeit integriert. In einem feinsinnigen Gespräch2 tasten drei Frauen miteinander die verschiedenen Qualitäten des Weiblichen ab. Es geht dabei in erster Linie darum, einen Raum zu schaffen, in dem niemand ausgeschlossen wird. Und es geht darum, diesen Raum zu halten, auch wenn nicht alles mit dem eigenen Verständnis in Übereinstimmung ist. Es geht um eine Zuwendung zum Unauffälligen, um einen nicht-selektierenden Blick und die Zartheit als reale Kraft, um eine Art seelischer Gastfreundschaft, bei der die Tür geöffnet wird, noch ehe man weiß, wer davorsteht. Diese Qualitäten lassen sich auch im Männlichen bezeugen, wie eine erweiterte Form des Selbstseins. Eine Qualität wird auf die Schaffensebene der Potenz gehoben. Potenz ist reines Vermögen, was keine Bestimmung in sich trägt. Die Intention, die der Potenz innewohnt, setzt den Schaffensprozess in Bewegung und wird wirksam. Wo die Intention wirksam wird, entsteht Resonanz.
Ein Beispiel ist das Vermögen, sich zu verbinden. Verbinden findet nur mit einer Andersheit (das andere in der Natur, in der Welt, das andere im Mitmenschen, das andere in sich selbst) statt. Zwischen zwei Gleichheiten gibt es keine Verbindung, es sei denn, das eine geht im anderen auf. In der Intention lebt das Verlangen nach einem Sich-Verbinden, welches sich ohne äußeren Anlass in Bewegung setzen kann. Es ist ein Sich-schaffend-aus-dem-Nichts-Bewegen. Denn es geht um den Akt des Sich-Verbindens. Danach sucht mein Verlangen. An diesem Punkt erscheint das Feminine als dasjenige, das sich auf der Schaffensebene des Möglichen, der Potenz bewegen kann. Es entfaltet sich und wird wirksam im Fluss des Werdenden.

Gemeinsamer Erlebnisraum
Es kann kein Vermögen geben, das nur für die Frau oder nur für den Mann vorbestimmt worden wäre. Es wäre dann kein Vermögen mehr, sondern Fähigkeit. Aus einer Fähigkeit können Qualitäten wachsen. Den Fähigkeiten aber kommt es zu, sich so zueinander zu verhalten, dass aus ihrem gegenseitigen Wechselspiel ein Erlebnisraum eröffnet wird. In dem kann sich das ‹Feminine› momentweise aufhalten. Als Beispiel könnte hier die mittelalterliche Kultur der Minnesänger und Troubadoure genannt werden. Von Okzitanien ausgehend haben sie sich ostwärts verbreitet und eine neue Bilderwelt geschaffen, in einer lyrischen Sprache, in der sich Wort und Klang vereinigen. Sie sangen von der hohen Kunst der Liebe, der Minne. Die Bilder, die man in den Miniaturen findet, sind noch immer voller Lebendigkeit. Mann und Frau begegnen sich in ihrem gegenseitigen Anblicken in einem blühenden Garten. Zwischen ihnen webt und wächst ein zarter Strauch, ein junger Baum, dessen Wurzeln sich festigen. Seine Blüten tragen bald Früchte. Wie ein Hauch legt sich das Feminine um sie beide, um ihrer beider Antlitze und Gestalt. Es singt ein aus der Zeit herausgehobener Moment.
Heutzutage ist das ‹Feminine› ein leiser Ruf, der zart und klar durch die Debatten und Antagonismen webt, aber sich dennoch vernehmen lässt. Es wird zur Kunst, das Ringen um das Feminine nicht aus seiner Schaffensebene herausfallen zu lassen. Es kommt darauf an, den Erlebnisraum des Möglichen als Dimension des Menschlichen offen zu halten. Und dieser Raum ist nicht unmittelbar an Geschlecht und Gender gebunden. Sowohl Frauen als auch Männer haben gleichermaßen Zugang zu dieser Modalität des Möglichen. Wobei Geschlecht und Gender, in ihrem wechselseitigen Austausch, eine grundlegende Mehrstimmigkeit bilden. Geschlecht – als vorgegebene Stimme im Grundton – und Gender-Identität, die sich daraus entwickeln lässt, sind notwendig, damit diese neue Dimension, ähnlich wie die Obertöne, sich offenbaren kann. Jeder, ob Mann oder Frau, kann einstimmen, kann die eigene Stimme einsetzen. Gleichzeitig kann das Feminine sich vom Grundton loslösen und als unverwechselbarer ‹Eigenton› vernehmbar werden. Es bringt sich als ‹erweiterndes Eigensein› zum Vorschein. Letztendlich ist das Feminine eine Frucht, deren Samen nicht gegessen, sondern gepflanzt werden will.

Adams Rippe
Den Ausdruck ‹Das Feminine› kenne ich von Emmanuel Levinas (1906–1995). Er nennt es ‹le féminin› im Unterschied zu ‹Frau› (la femme) und ‹Weiblichkeit› (la féminité). In einer seiner ‹Talmudischen Lektüren› erklärt er die Stelle der Genesis, in der Gott aus Adams Rippe die Frau schuf. «Gott baute eine Frau aus einer Rippe, die er dem Mann genommen hatte.» (Gen 2,22) Levinas gibt die beiden Hauptinterpretationen talmudischer Leseart wieder, aus denen sich durch die Jahrhunderte alle weiteren Kommentare und Deutungen entwickelt haben.3 In der ersten Interpretationsreihe ist die Rippe ein ‹Anhängsel›. Sie kommt nach der Erschaffung des Mannes. In der zweiten Interpretationsreihe kann die Rippe als Antlitz verstanden werden. Nach vielen Wendungen deutet Levinas, dass Gott den Menschen erst geschaffen hat als ein einziges Antlitz, als Ebenbild Gottes. Gott als der radikal andere hat kein Antlitz, er ist Antlitz. Aus diesem einen Antlitz schuf Gott zwei: gleichzeitig und einander ebenbürtig. Darauf aufbauend gewährt Levinas in seinen letzten philosophischen Schriften der «Transzendenz der Andersheit», die mich im Blick des anderen gefesselt hält, ihren berechtigten Ort. Emmanuel Levinas hat das Antlitz eines jeden Menschen als Ort der Epiphanie des Menschlichen dargestellt. Aber nicht so, dass ich im Antlitz des Mitmenschen dem anderen als einem ‹Menschen, so wie ich› begegne. Levinas meint, dass nur die Andersheit mir als Antlitz entgegenkommen kann. Die Ethik als Verantwortung für das Antlitz des anderen, ihm also seine Andersheit zu gewähren – zum Beispiel in der Gastfreundschaft – ist bei Levinas eine der Gebärden des Femininen. Es entsteht dadurch eine Offenheit auf der Ebene des Möglichen als Dimension des Menschlichen. Das Feminine lässt die Andersheit herein, eröffnet die Möglichkeit, dass sie sich als Antlitz offenbaren kann, ohne dabei sich selbst offenbaren zu müssen oder zu wollen.
Das Feminine rührt uns an
Im Sommer 1981 verbrachten wir einen Familienurlaub in der Umgebung der alten okzitanischen Bischofsstadt Albi. In der Nähe fand ein Seminar zum Thema ‹Heilige Texte und wie sie (nicht)‚ gelesen, werden können› statt. Ich hatte mich schon vorher entschieden, mit unseren vier kleinen Mädchen den Tag zu verbringen, und freute mich darauf. Ihr Vater nahm an den Gesprächen teil. An dem Tag jedoch, als Emmanuel Levinas am Beispiel einer Bibelstelle zum Gespräch lud, ging ich doch mit. Das Treffen fand in einer Privatwohnung statt und zu meiner Überraschung war ich nicht die einzige Frau. Als wir eintraten, saßen Levinas und seine Frau Raïssa nebeneinander an einem ganz gewöhnlichen Tisch und wir setzten uns dazu. Von ihnen ging eine fast spürbare Wärme aus. Alle Spielarten von Humor, Sanftmut und Unbefangenheit woben ineinander. Sie war bei einer Strickarbeit, er las vor und kommentierte. Kaum wechselten sie einen Blick miteinander. Die aufgeregte Stimmung der Begrüßung, die Spannung der anstehenden Diskussionen, die es zu Beginn gab, legte sich. Es wurde ruhig. Innerlichkeit stellte sich ein und Stille. Allmählich wurde die Intensität ihrer und seiner Präsenz wirksam – ihrer beider zusammen. Sie hatten einander mit Anfang zwanzig in Kaunas kennengelernt, wo sie im gleichen Stock mit ihren Familien lebten. Ihrer beider Präsenz hier im Katharerland war alles andere als ‹beeindruckend›. Sie wirkten graziös, heiter und leicht. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, kann ich nur sagen: Wir sind gesegnet worden. Zwischen ihnen lebte eine Anwesenheit, die unsere Herzen erleichterte und uns eine Last wegnahm, von der wir nicht einmal wussten, dass sie gedrückt hatte – bis zu dem Moment, in dem wir einen Augenblick lang erfahren konnten, was es heißt, zu Hause zu sein. Und in uns dieses winzige, zitternde Leben zu spüren, das nie erlischt. Etwas hatte uns berührt. Abends zurück in unserer Ferienwohnung rannten die Mädchen, die Ältesten voran, zu ihrem Vater. Ich ging in die Küche und schaute, ob es noch Brot gab.
Berührung ist wesentlich ein Gegenseitiges: Wer anrührt und wer angerührt wird, sind ihrer beider Seiten. Manchmal auch so, wie wenn aus zwei Saiten einer Geige, beide von einem Bogen angestrichen, eine einzige Stimme klingt. Eine zarte Schwingung, eine Resonanz wie ein Summen beginnt. Aus diesen Schwingungen löst sich ein stetig sich ausdehnendes Erleben heraus. Die Sehnsucht aber bleibt. Wäre sie gestillt, hätte man nur sich selbst empfunden.

Potenzierung des Eros
Gerade im Spannungsfeld von zwei ‹Andersheiten› erscheint das Feminine als Potenzierung des Eros. Dieses Erscheinen ist alles andere als eine Synthese der zwei Gegenpole weiblich/männlich, und auch nicht ein drittes Element, das die beiden in sich aufhebt. Die Eigenart des ‹Femininen› zeigt sich im Bewahren und Erhalten der Andersheit – beider Arten der Andersheit und der Spannung zwischen beiden. Es geht darum, die Spannung erhalten zu können! Aus den Qualitäten des Männlichen und des Weiblichen entsteht auf einer höheren Ebene ein Drittes, das Feminine. In ihm werden die beiden zugänglich und haben so an der Potenzierung teil. Wenn das Feminine zu einer einzelnen Andersheit, zum Beispiel nur zum Weiblichen, reduziert wird, kann keine Potenzierung aus der Mehrstimmigkeit stattfinden. Die Sehnsucht nach Berührung führt nicht zur Erfüllung, wenn man die Schaffensebene des Femininen offenhalten will. Jedes Zuschreiben, jedes Einordnen würde ihm das Vermögen nehmen, schaffend zu werden. Dabei geht es nicht um einen Zusatz, der ‹weiblich› und ‹männlich› ergänzt. Das Feminine kann auch nicht praktiziert werden, denn dann wäre es die Rückkehr zu einem Rollenmodell, das jemand sich selbst auferlegt. Es soll entstehen können aus der Potenz. Deswegen sind beide, weiblich und männlich, prinzipiell unvollendet, denn Potenz trägt keine Bestimmung in sich. Man kann sich also auch nicht vornehmen, das Feminine zu üben. Auch das Menschwerden wird nur dadurch möglich, dass es unvollendet ist. Es geht um eine ‹Mehr›, welches beide erhöht und doch jedes in seiner Unzulänglichkeit, seinem Unvollendetsein würdigt. Erst dann entsteht Mehrstimmigkeit, die hohe Kunst, der Stimme der Andersheit Raum zu schaffen, indem man selbst singt. Das ist das innere Geheimnis der Kultur der Minne, aus der sich die ‹Fedeli d’Amore› um Dante und seinen Kreis später entwickelt haben. Wer liebt und wer geliebt wird, soll sich im Spiel der Liebe wechseln können, damit in der Mitte ein Drittes Blüte und Frucht tragen kann. Erfüllung wäre wie ein Same, den man isst, statt ihn zu pflanzen. Eines der Geheimnisse der hohen Minne ist, dass die Erfüllung schon vor allem Anfang da war. Das Mögliche ist zuerst da und aus seiner Fülle singen wir das Lied eines neuen Anfangs. Immer wieder. Immer neu.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
Nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
Der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
Oh süßes Lied.4
Zeichen der Verletzlichkeit
Eine junge Frau trägt ihr kleines Kind vor sich auf dem Arm, während sie auf uns, die sie anschauen, zuschreitet. Ihre Füße schweben über einem Boden, der nur aus Wolken besteht, fast ohne diese zu berühren. Ihr Schreiten zeigt Leichtigkeit und Geschwindigkeit. Ihr Schleier wölbt sich bei jedem Schritt. Ihr Schreiten auf uns zu ist aber zugleich ein Absteigen. Ihr Blick schaut auf dasjenige, was da unten sich Schritt für Schritt offenbart. Sie bahnt sich einen Weg. Es ist nicht ihr Weg. Es ist der Weg des Kindes, das sie scheinbar mühelos trägt. Bald werden beide ganz unten angekommen sein. Aus der Ganzheit sind sie in der Schwere angekommen. Der Weg und die Wunde werden jetzt auch ihre. Im Sommer 1955 stand Wassili Grossman vor der ‹Sixtinischen Madonna›, dem Altarbild Raffaels, das als Kriegsbeute 1945 von den Russen mitgenommen und im Puschkin-Museum ausgestellt worden war. Als Kriegsjournalist hatte er das unsagbare Leiden und das Abgründige des Zweiten Weltkriegs in seinen Berichten ‹mitgeschrieben›. Von dem Moment an, als er die Madonna anschaute, fand in ihm eine nie endende Offenbarung statt: «Ich sah eine junge Mutter, die ein Kind auf dem Arm hält», schreibt er. «Wie lässt sich der Zauber eines zarten, schmächtigen Apfelbaumes beschreiben, der den ersten schweren, weißhäutigen Apfel hervorgebracht hat; […] die Mutterschaft und die Schutzlosigkeit eines Mädchens, das fast noch ein Kind ist?» Zehn Jahre nach Kriegsende taucht das Abgründige eines Krieges wieder in ihm auf: «Warum gibt es keine Angst im Gesicht der Mutter, warum hat sie den Körper ihres Sohnes nicht mit solcher Kraft mit den Händen umschlossen, dass der Tod ihre Finger nicht öffnen kann, warum will sie den Sohn nicht dem Schicksal entreißen?» Unzählige Male ist sie ihm in den Kriegswirren entgegengekommen, eine Mutter mit ihrem Kind. Jetzt kommt sie ihm vom Altarbild entgegen. In ihr sieht er seine Zeitgenossin. «Sie ist ein Teil unseres Lebens, unsere Zeitgenossin.» Ihr Sohn aber ist es, der ihm das Herz eröffnet. Grossman sieht in ihm, wie das «Menschliche am Menschen […] seinem Schicksal entgegentritt. Und wie Verletzlichkeit die Gegensätze verbindet und heilt, damit das Menschliche im Menschen nicht verlorengeht, denn Größeres gibt es nicht.»5

Karo Kollwitz, geboren 1976 in Braunschweig, studierte von 1996 bis 2000 Freie Kunst an der Fakultät Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Universität Weimar. Nach einem Wechsel zur HGB Leipzig diplomierte sie 2002. Von 2003 bis 2006 absolvierte sie einen Master of Fine Arts in Helsinki/Finnland und Weimar als Studienstipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Karo Kollwitz erhielt diverse Kulturförderungen und Stipendien (Graduiertenstipendium der Bauhaus-Universität Weimar, Arbeitsstipendium und Projektförderungen der Kulturstiftung Thüringen). Seit 2009 ist sie regelmäßig als Gastdozentin an der Bauhaus-Universität Weimar tätig. Sie lebt und arbeitet in Weimar.
Kunst im öffentlichen Raum Objekt | Installation | Zeichnung.
Fußnoten
- Vgl. Goetheanum 33/34, 15. August 2025, Ästhetik als spiritueller Weg.
- Vgl. Goetheanum 18, 2. Mai 2025, Dem Unbekannten Heimat geben.
- Emmanuel Levinas, Du sacré au saint, Cinq nouvelles lectures talmudiques. Les Éditions du Minuit, Paris 1977.
- Rainer Maria Rilke, aus: Liebeslied, 1907.
- Wassili Grossman, Die Sixtinische Madonna. In: ders., Tiergarten. Erzählungen, Berlin 2008.