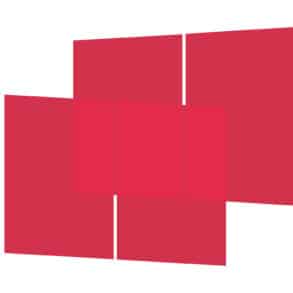Eindrücke vom Fest in Stuttgart zum 100. Todesjahr von Rudolf Steiner.
Was für ein Bild: Vor der Fassade des neoklassizistischen Königsbaus mit seinen 34 Säulen, umarmt von Schloss und Schlossplatz, reihten sich bei sonnigem Wetter am letzten Märzwochenende die weißen Veranstaltungszelte ‹2025 Steiner Festjahr›. Wie ein gutes Dutzend einzelner Häfen säumten die Zelte den Menschenstrom an der Fußgänger-Hauptschlagader Stuttgarts. Bis zu 10 000 Menschen laufen und schlendern hier pro Stunde entlang und sind dabei – typisch für einen Einkaufsboulevard – offen für Inspiration, offen für Neues. Doch anders als die Einkaufstempel, die den Blick bannen, den Schritt zu lenken versuchen, waren die Zelte mit dezenten Bannern und Hinweisen gekennzeichnet. Von außen beinahe still, als wollten sie mit dem schweigenden Anteil unserer Seele sich zusammentun, da, wo wir nicht haben wollen, sondern sein wollen. Außen standen nur einzelne Titel wie ‹Notfallpädagogik›, ‹Wasser› oder ‹Meditation›. Matthias Niedermann vom Organisationsteam der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland (AGID) erklärt mir den Hintergrund: «Das anthroposophische Credo von tiefer Esoterik und breiter Öffentlichkeit wollten wir verschränken: Wie anders als durch Zurückhaltung und Stille kann man äußerlich Spiritualität zeigen? Sie wandelt sich dann, wenn du in die unmittelbare menschliche Begegnung eintrittst.» Die freundliche, freie Atmosphäre an den drei Tagen hatte noch weitere Ursachen. Dazu gehörte das luftige Design, das die klassisch-anthroposophische Roggenkamp-Schrift aufgegriffen und spielerisch transformiert hat, dazu gehörten die zum Himmel strebenden Zeltspitzen und dazu gehörte das Miteinander des Organisationsteams. Am Freitagmittag standen sie vor der Eröffnung mit allen Helfern und Helferinnen wie eine eingeschworene Fuß- oder Handballmannschaft im Kreis. Da war schon zu spüren, was Sebastian Knust vom Team der AGID als den ‹sozialen Griff› beschrieb: Jedes Zeltteam, von der Berufsberatung über Demeter bis zur Firma Sonett, war selbstverantwortlich aktiv. Die Zeltstadt war ein freies Miteinander und Füreinander.
In einem Zelt wurde Rudolf Steiner im Wortlaut vorgelesen. Auf weißen Quadern saßen mal zehn, mal fünfzig Passanten und hörten zum Beispiel Wolfgang Müller aus GA 231 lesen. Wenn man vor dem Übersinnlichen haltmache, dann mache man zugleich vor der menschlichen Selbsterkenntnis halt, beschreibt hier Rudolf Steiner. «Dann verzichtet man darauf, das Wertvollste, das Würdigste im Menschen selbst zur Einsicht zu bringen.» Hinter dem vorlesenden Wolfgang Müller sah man durch die Zeltfenster die strömenden Menschen. Was für ein Bild der Anthroposophie: Man muss nur für einen Moment aus dem Strom vom Kaufen und Erledigen aussteigen, und schon vermag das vor 102 Jahren in Den Haag gesprochene Wort von Rudolf Steiner die Seele zu rühren. Hier wird Rudolf Steiners erster Satz in ‹Die Schwelle der geistigen Welt› zum Bild. Da schreibt er, dass das Denken wie eine Insel inmitten der Fluten des Seelenlebens sei. Im Sturm der Leidenschaften trete Ruhe ein, wenn das Seelenschiff sich bis zur Insel des Denkens hingearbeitet habe. Ein solches Seelenschiff war das Vorlesezelt in den Einkaufsfluten der Königsstraße. Noch inniger war es dann wenige Meter abseits des Menschenstroms. Die Christengemeinschaft feierte zweimal in vollem Zelt die Menschenweihehandlung.

Politisch-eurythmische große Bühne
Politisch wurde es im Omnibus für direkte Demokratie und im Podiumsgespräch auf der Festbühne mit Angelika Wiehl (Alanus-Hochschule), Boris Palmer (OB Tübingen), und Gerald Häfner (Goetheanum). Von dort spielten Schüler der Waldorfschule Offenburg aus Beethovens 7. Sinfonie, sang der Chor des Freien Jugendseminars Stuttgart und zeigte Eurythmie, dass manche Gebärde es mit der Weite des Schlossplatzes aufnehmen kann. Das galt auch für den abendlichen Auftritt der brasilianisch-deutschen Sängerin Bê Ignacio mit Band. Vermutlich kann niemand mit mehr Charme von seiner anthroposophischen Sozialisation erzählen als diese Musikerin. In einem Zelt und einem Pavillon gab es fortlaufend Podiumsgespräche über Gesundheit, Bildung, Anthroposophie oder Wirtschaft. Manche Gäste schnappten ein paar Sätze auf, andere blieben die 45 Minuten eines Podiums sitzen. So bildeten sich Ad-hoc-Erkenntnisgemeinschaften und lösten sich anschließend wieder auf. Für den schnellen Ein- und Überblick lief in einem Zelt als Schleife der Film von Börries Hornemann ‹Waldorf, Demeter, Anthroposophie – sind Rudolf Steiners Ideen noch aktuell?›. Seine orangefarbene Mütze, die er im Film trägt, sah man auch im Strom der Menschen immer wieder aufleuchten.
Der Kongress ‹Soziale Zukunft› von 2017 in Bochum und der wegen Corona abgesagte Folgekongress waren konzeptionelle Vorläufer des Steiner-Jubiläums und auch Ideenschmieden, wie auch das Bildungsfestival 2024 in Schloss Hamborn, und doch sind diese mehr internen Events nicht zu vergleichen mit dem Stuttgarter Steiner-Jubiläum auf dem Schlossplatz, das alle bisherigen anthroposophischen öffentlichen Ereignisse sprengte. Die dreitägige Veranstaltung verlief so leichtfüßig, dass man einen Blick in Monika Elberts (Generalsekretärin der AGID) lächelndes, ungläubiges Kopfschütteln nehmen musste, um die Hürden und Widerstände zu ahnen, die das Team hier bewältigt hat. Drei Agenturen waren mit im Boot: eine Designagentur, eine Eventagentur, die große Fahrradrennen organisiert, und die Kommunikationsagentur Factum, die vertritt, Anthroposophie offensiv zu kommunizieren. Das behördliche Okay ließ bis wenige Tage vor dem Fest auf sich warten, und als sich manche Widerstände türmten, kam die Ruhe und Beharrlichkeit von Michael Schmock, der das Vorhaben vor seinem Ausscheiden mit initiiert hatte, zur Hilfe. Das gilt auch für das Netzwerk der anthroposophischen Verbände, das als Trägerkreis für solche Initiativen zusammenarbeitet. Sebastian Knust: «Ohne so ein gewachsenes Vertrauen lässt sich eine solche Initiative nicht stemmen!»

‹Vielfalt lieben› war das Motto des Steiner-Jubiläums. Ganz wie das Fest selbst hatte auch dieses Motto die Spanne von frühlingshafter Leichtigkeit und angesichts des Vormarsches Vielfalt verneinender Politik auch etwas von schicksalhaftem Ernst. Etwa ein Drittel der Zeltbesucher und -besucherinnen habe keine oder nur geringe anthroposophische Bildung mitgebracht – so die Auskunft einiger der Zelt-Verantwortlichen.
Welche Wirkung – und hier muss man noch im Futur sprechen – wird vom Fest ausgehen? «Ich bin dankbar, dass wir den Mut hatten», sagte Martin Merckens, Priester der Christengemeinschaft in Stuttgart, und tatsächlich war das Wochenende auch eine Schulung, ein ‹Empowerment› für anthroposophisch-öffentliches Auftreten. ‹2025 Steiner Festjahr› hat geholfen, die Zweifel aus der Corona-Zeit aufzubrechen, Gräben zu schließen, ja es hat die anthroposophische Kulturarbeit enger mit der allgemeinen Kultur verbunden.
Bilder von den Feierlichkeiten in Stuttgart. Fotos: Wolfgang Held