Mensch zu sein bedeutet, Mensch werden zu wollen, die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und das heisst, frei werden zu wollen. Doch wie wird man frei, ohne das Miteinander zu verlieren? Das Spiel zeigt die Richtung, denn im Spiel ist man heiter und ernst. Die Schönheit gibt einen Schlüssel. Sie bringt individuelles und allgemeines, Ich und Menschheit zusammen.
Kürzlich hatte ich einen Traum. Eine sich langsam über die ganze Welt bildende Gesellschaft von Menschen aller Horizonte und Firmamente suchte nach dem Eigentlichen. Nach und nach stellten sie fest, dass das Eigentliche da ist, wo jemand sein Dasein heiter ernst zu nehmen vermag, in dieser Weise dann einmalig und wirklich wird – und damit den politischen Menschen verkörpert.
Also ernst und heiter, ein heiterer Ernst, eine ernste Heiterkeit. So standen sie zum Dasein, so fasste diese Traumgesellschaft das Dasein auf. Jene, die sich und einander so sahen, wurden wirklich und einmalig. Keiner von ihnen kam mehr auf die Idee, etwa den einen mit dem anderen oder den anderen mit dem einen zu vergleichen. Es wäre ein Absurdum, fremd dem Einmaligen.
Allerdings blieb die Bedingung im Traum – und sie schien allen selbstverständlich und klar zu sein –, dass jeder dieser Menschen mindestens von einem gesehen wird und einen anderen sieht. Es braucht Wechselseitigkeit als Daseinsbedingung, um einmalig und wirklich zu werden.
So begann was nicht nur Traum, sondern im wachen Bewusstsein zur Möglichkeit wird: Menschen sind unverwechselbar einzelne und zugleich politische Wesen; sie sind in sich begründet und zugleich Teil eines Gemeinwesens; unverwechselbar und gesellschaftlich. Hier erscheint ein überwundener, besser: ein transformierter Gegensatz: Individuum und Gesellschaft sind ‹unvermischt und ungetrennt›.
Erwachen freier Schönheit
Schiller erwachte im späten 18. Jahrhundert an Kants Bewusstheit und entdeckte im träumenden Wachen zwei Kernbegriffe kommender Lebenskunst: Wechselseitigkeit und Verwandlung. Verwandlung durch Wechselseitigkeit – das Mysterium einer ästhetischen Erziehung des Menschen, Geburt eines neuen Schritts zu einem menschlichen Denken, Urteilen, Handeln.
Die Schiller’schen ‹Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen› dokumentieren eine unerhörte Entdeckung. Das späte 18. Jahrhundert ist ja die Wiege von so vielem, in dessen Folgen wir heute leben. In Mitteleuropa entstand die Aufklärung. Sie realisierte, dass die Ratio, der Verstand, die Intellektualität die Welt anders begreifen und organisieren kann. Parallel erwachte ein völlig neues Verständnis von Materie und Prozessen, von Technik und Wirtschaft. Die Industrialisierung begann.
Kant ist der Hüne dieser Reflexionskraft. Er stellt die entscheidenden Fragen, auf Descartes fußend, um die Ratio handhabbar zu machen – im Hinblick auf das Denken selbst, also für das Erkennen; im Hinblick auf die politische Wirklichkeit, also wie gesellschaftliches Handeln bewusst möglich wird; im Hinblick darauf, wie wir Urteile bilden, also für die ästhetische Dimension.
Kant war klar, dass unser Schönheitsempfinden eine eminent subjektive Angelegenheit ist. Schönheitserfahrung ist wohl subjektiv, aber sie ist eminent, also mehr als nur subjektiv, verbunden mit einer unabhängig vom Subjekt bestehenden Wirklichkeit – Schiller wurde in der Auseinandersetzung mit dem großen Lehrer, mit den politischen Umwälzungen seiner Zeit und seiner Freiheitsliebe immer klarer: Schönheit ist die objektivste Sache, die es gibt; sie ist individuell und nur individuell erfahrbar. Schönheitsempfinden als das Universellste, zu dem allein ein ganz individueller Zugang führt, wird zum Schlüssel einer neuen, einer wirklich freien, also menschlichen politischen Ordnung, «weil es die Schönheit ist, durch welche man zur Freiheit wandert». (1. Brief)
Da taucht die Spannung auf, in der wir heute, mehr als zweihundert Jahre später, leben: Ich weiß, ich bin ein individueller Mensch. Da ist aber eine ganze Welt und sie geht ihren Gang. Bin ich mitverantwortlich? Wie ist das Verhältnis zwischen mir als persönlich empfindendem Menschen und einer allgemeinen Menschheit, ja dem Schicksal der Erde? Wie hängen das Einzelne und das Allgemeine, wie das Objektive und das Subjektive zusammen?
Keine philosophischen Fragen mehr, sondern existenzielle. Aber wo sind die Folgen der Entdeckung ästhetischer Erziehung heute zu sehen?
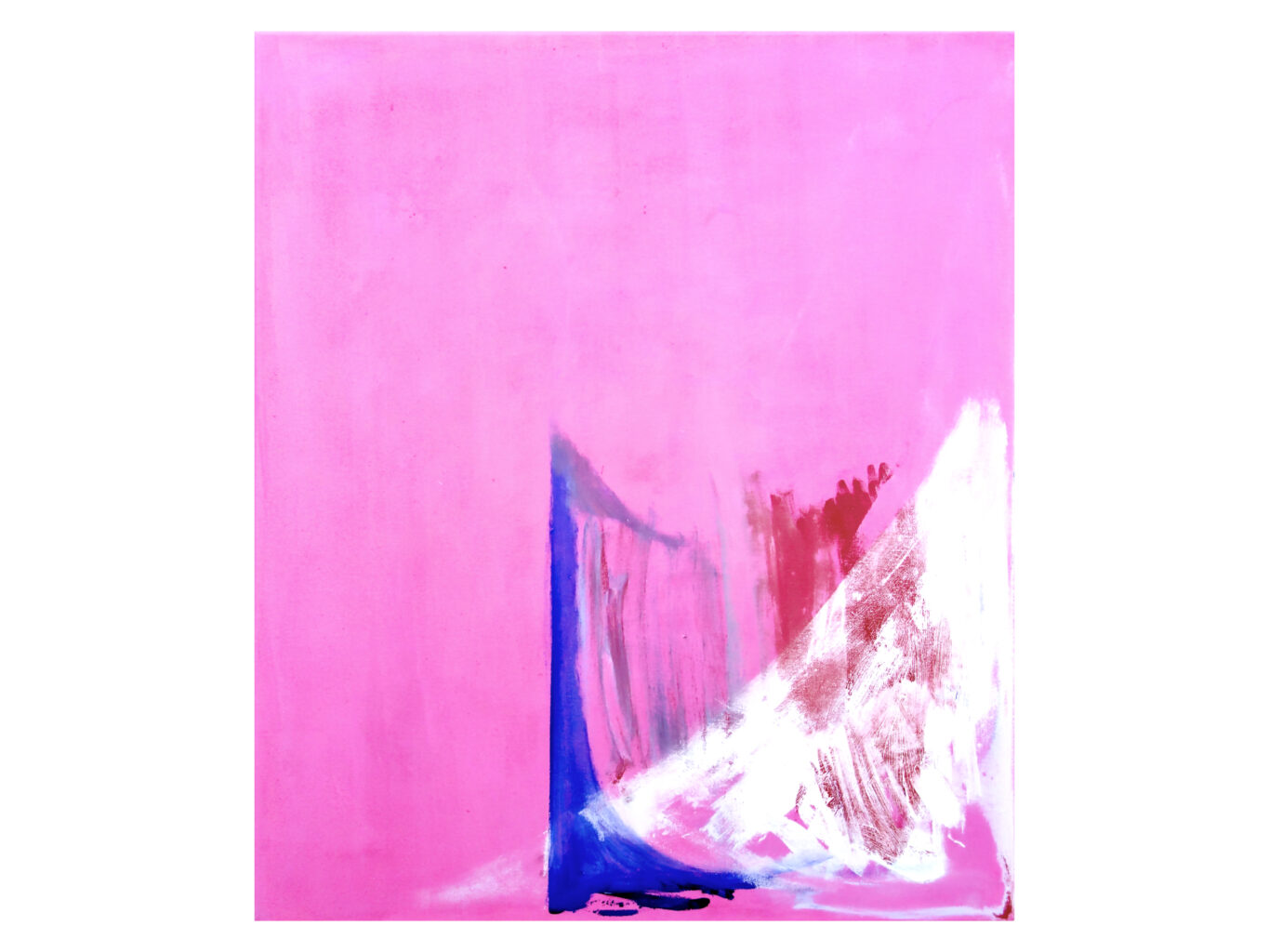
Drei Schwellen
Schillers Ausgangsfrage ist politisch: Wie wird in einer Gesellschaft menschenwürdiges Leben möglich? Wie verlieren wir weder die Welt, wenn wir uns entdecken, noch uns selbst, wenn wir die Welt lieben? Wie gewinnen wir unsere Menschlichkeit in den Gesellschafts- und Zivilisationsverhältnissen, die wir schaffen, und wie realisiert eine menschengemachte Welt ihre Menschlichkeit?
Das bis dahin prägende feudale System des hohen und späten Mittelalters entsprach immer weniger einer Wirklichkeit der in ihm lebenden Menschen, ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Verhältnissen. Zunehmend suchten sie (vergeblich?) nach privaten und gesellschaftlichen Lebensformen, in denen jeder Einzelne an den Gestaltungs- und Entscheidungsvorgängen des Ganzen teilhaben kann. Wie man Leben und Gesellschaft überhaupt denken, erfahren und leben wollte, wandelte sich grundlegend – kurz: Es ging um ein Erwachen aus der Fremdbestimmung durch Natur und andere Menschen, ein Erwachen zur Selbstbestimmtheit. Damals änderte sich wohl mindestens so viel wie heute, wo wir in einer selbstgemachten virtuellen Welt leben lernen (müssen) und begreifen, dass das Überleben der Erde davon abhängt, wie wir leben (wollen). Wir stehen an einer anderen, existenzielleren Schwelle, die damalige aber ist ihre Voraussetzung. Und birgt vermutlich die Keime, sie zu überschreiten.
Die Schwellenfrage heißt: Wie leben?
Sind wir nicht heute schon in eine Epoche eingetreten, in der Gesetze und Bedingungen unser Dasein formen, die dem Bewusstsein, nicht nur der Natur entstammen? Haben wir als Menschheit bereits eine Schwelle im Leben überschritten, die der Einzelne erst Schritt für Schritt im Bewusstsein überschreiten muss, um wirklich im Leben zu stehen? Haben wir diese Schwelle zeitlich zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahrhundert überschritten – unbewusst? Und bemerkten es mehr und mehr, erst Einzelne wie Schiller, dann mehrere, bald viele Menschen im Laufe des 20. Jahrhunderts, und schließlich wird sich eine Menschheit des beginnenden 21. Jahrhunderts immer klarer, dass jeder einzelne Mensch eine Schwelle im Bewusstsein überschreiten will, die sie im Leben bereits überschritten hat? Eine Schwelle zu welchem Bewusstsein?
Wie leben – im Bewusstsein?
Schiller begriff, dass der Mensch (nur) durch seine Verbindung mit der Schönheit frei wird. Er sah, dass Leben und Bewusstsein in der Schönheit zusammenkommen, dass in ihr dieser scheinbar unversöhnliche Gegensatz nicht etwa aufgehoben, aber verwandelt ist. Er suchte nach einem Reich, einem Staat, einer Ordnung der Gesellschaft, in der dies möglich wird, in der «fein gestimmte Seelen» (27. Brief) leben könnten.
Heute sind eigentlich alle Menschen «fein gestimmte Seelen», scheint mir. Es ist die Rückseite der rationalen, der industriellen, möglicherweise erst recht der digitalen Entwicklung, die mit wachsender Geschwindigkeit dazu führt, dass die Seelen sehr fein gestimmt werden, sehr sensibel, scheu, ängstlich, aufmerksam, unsicher, suchender, selbstverantwortlicher werden im Fragen: Wie und in welcher Welt lebt mein Bewusstsein; in welchem Bewusstsein lebe ich?
«Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grundgesetz dieses Reichs.» Eine Ordnung «des schönen Scheins», die dem Bedürfnis nach in jeder feingestimmten Seele lebt (ebd.).
Da also, in der fragenden Seele! Dann sucht sie, findet nicht; bemerkt, früher oder später, leichter oder schmerzvoller: Sie muss selbst tätig werden; Selbstbestimmung, eben und noch kaum erlangt, wird schöpferisch. Schließlich entsteht nicht in ihr, aber dort, da draußen, zwischen den Menschen, dann auch und endlich mit der Erde eine freie, also gewollte Ordnung des «schönen Scheins» – früher oder später, leichter oder schwieriger.
Wirklichkeit des schönen Scheins
Der «schöne Schein»? Was ist dieser schöne Schein? Hängt mein skizzierter Traum mit seiner Wirklichkeit zusammen? Ja, er erwacht durch Wechselseitigkeit und Verwandlung zum schönen Schein, zur Wirklichkeit jenseits des Gegensatzes von Natur und Selbstbewusstsein.
Wenn ich morgen der bin, der ich heute war, werde ich unwahr, denn ich werde nicht mehr. Bin ich es nicht, werde ich unwahr, weil dann keine Konsequenz in meinem Dasein ist.
Ein normaler Mensch hat eine rationale, formende und gestaltgebende Kraft. Da setzt sich das Bewusstsein ständig ins Verhältnis zu dem, was außen oder innen geschah und geschieht. Gleichzeitig sind wir sinnlich, physisch lebendige Menschen und wissen oft nicht, warum wir wollen, was durch unseren Leib, unsere Triebe, Neigungen, Bedürfnisse und Leidenschaften, durch unser Leben geschieht.
Schiller beurteilt diese Seiten nicht mehr moralisch, spielt aber unermüdlich mit ihnen als gegensätzliche menschliche Gegebenheiten und Möglichkeiten, aus denen, wo sie miteinander ins Spiel gebracht und nicht gegeneinander ausgespielt werden, eine neue Wirklichkeit werden kann – ein Schein, der schöne: menschliche Wirklichkeit, nicht nur objektiv, nicht nur subjektiv; nicht nur menschengemachte, sondern menschengewollte Wirklichkeit.
Als Hauptgegensatzpaar beobachtet er einerseits das Bewusstsein, aus dem sich der Mensch eine Form gibt, die über ihn hinausführt, und auf der anderen Seite die Empfindung, in der er sich selbst anheimgegeben ist. Er beschreibt beide in zahllosen Varianten, bis sie schließlich als Kräfte in Form- und Stofftrieb einander hervorbringend und empfangend ein Neues, Drittes bilden: den Spieltrieb. (14. Brief)
Der Trieb zu spielen ruft eine individuelle, einmalige, immer unvorhersehbare Verbindung zwischen Stoff und Form, zwischen Geist und Materie ins Leben. Hundert Jahre später heißt es bei Steiner in der ‹Philosophie der Freiheit›: Natürlich gibt es einen Dualismus in der Welt: Materie und Geist; aber es gibt ein Wesen, das ganz aus diesen beiden komponiert ist. Und dieses Wesen ist eins. Es wird (und muss) sich selbst zunächst für dualistisch halten, wenn es sich seiner selbst bewusst wird; aber an sich ist es eins. Das zu realisieren nennt Steiner Erleben der Idee, Monismus, der erst wirksam wird, indem sich der Mensch seines tätigen Bewusstseins in der Welt (als Welt) bewusst wird.
Je mehr Schiller erkennt, was Steiner hundert Jahre später so formuliert, dass es in die Lebens-, Kultur- und Berufspraxis, ja, in eine Hochschulform Einzug halten kann, schafft er philosophisch-poetisch eine neue Welt, zunächst gedanklich, aber menschlich einheitlich. Wie lange mussten Geist und Materie getrennt sein, wie fremd und feindlich einander werden, um sich endlich so – im Bewusstsein und von dort mit Perspektive auf das Leben (Franz Rosenzweig) – verbinden zu können?!
Hans Jonas schildert später, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in Rosenzweigs Nachfolge, in seinem Mythos des selbstverantwortlichen Menschen und des werdenden Gottes, wie die ganze schon lebendige Welt erzitterte, als dieses Wesen auftauchte: dieses wunderbare Wesen, das sich immer mehr und mehr selbst zu erkennen vermag; das erkennen lernt, indem es andere sieht, die auch zu erkennen vermögen und die einstige Allmacht Gottes in ihrem Erkennenkönnen entdecken, sodass Gott werdend wird.
Ich werde und bin; Gott ist und wird – die große Verwandlung. (‹Gottesbegriff nach Auschwitz›)
Diese Metamorphose durch die Wechselseitigkeit erwacht mehr oder weniger bewusst und willentlich. Es entsteht ein Drittes aus der Begegnung zweier Verschiedener, hier Gott und Mensch, dort Stoff und Form oder Materie und Geist oder Empfindung und Gedanke. Schiller nennt dieses Dritte das Spiel, dann den Spieltrieb, der den schönen Schein realisiert – realisiert im doppelten Wortsinn: Wahrnehmen und Verwirklichen.
Denken wird Fühlen und Wollen
In den ‹Ästhetischen Briefen› beginnt ein Denken, das ein neues Fühlen und ein neues Wollen, kurz: ein gestaltetes Leben, eine lebende Gestalt ermöglicht – mit einem Wort: eine Lebenskunst.
«Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materielle Sein und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des Formtriebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich fasst. Der Gegenstand des Spieltriebs in einem allgemeinen Schema vorgestellt, wird also lebende Gestalt heißen können; ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient.

Durch diese Erklärung, wenn es denn eine wäre, wird die Schönheit weder auf das ganze Gebiet des Lebendigen ausgedehnt noch bloß in dieses Gebiet eingeschlossen. Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist und bleibt, kann darum nichtsdestoweniger lebende Gestalt durch den Architekt oder Bildhauer werden. Ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange keine lebende Gestalt. Dazu nämlich gehört, dass seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt sei. Solange wir über seine Gestalt bloß denken, ist sie leblos, bloße Abstraktion. Solange wir sein Leben bloß fühlen, ist es gestaltlos, bloße Impression. Nur indem seine Form in unserer Empfindung lebt und sein Leben in unserm Verstande sich formt, wird er lebende Gestalt. Und dies wird überall der Fall sein, wo wir ihn als schön beurteilen.» (15. Brief)
Was für ein Vorschlag, aufmerksam darauf zu sein, wann ich Menschen als Impression oder als Abstraktion erlebe oder denke; und wie naheliegend, dass sie dann selten schön erscheinen. Erwarte ich aber keine Schönheit und versuche den Menschen in all seinen Bedingungen, seinem Erscheinen und Leben zu denken, seine Form und sein Bewusstsein zu fühlen und doch weder Abstraktion noch Impression zu meiden, ihr Miteinander vielmehr zu moderieren – beginne ich dann, ihn zu ‹sehen›? Beginne ich, Schönheit hervorzubringen?
Wer spielt wird schön
Schönheit hervorbringen? Spielerisch – also in heiterem Ernst, in ernster Heiterkeit? Ein Spiel, das «weder subjektiv noch objektiv zufällig ist und doch weder äußerlich noch innerlich nötigt», und die Anschauung des Schönen, wo sich das Gemüt «in einer glücklichen Mitte zwischen Gesetz und Bedürfnis befindet», ermuntern einander, gegenseitig zu werden, was sie jeweils vermögen. Ja, mehr noch: «Der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen». (Ebd.)
In diesem spielenden, schönen Menschen gewinnt eine Gestalt Leben und ein Leben Gestalt – auch in der Anschauung meiner selbst, vor allem aber in der Anschauung der Andersheit des anderen.
«Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Dieser Satz […] wird eine große und tiefe Bedeutung erhalten, wenn wir erst dahin gekommen sein werden, ihn auf den doppelten Ernst der Pflicht und des Schicksals anzuwenden.» (Ebd.
Spätestens hier beginnt eine neue, bewusste Humanisierung: Pflicht ersetzt Schiller durch (welche?) Freiheit und Schicksal durch Selbstbestimmung im Urteilen. Ich beginne, mein Urteilen zu beurteilen, statt das Urteilen zu verurteilen; ich werde wach in einer Tätigkeit, die ich zuerst erfuhr, als ich noch ohne alle Reflexion dieses mochte und jenes nicht. Und dieses Spiel wird «das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst und der noch viel schwierigeren Lebenskunst tragen» (Ebd.)
Lebenskunst hat offenbar zur Voraussetzung, dass ich beginne, mein Leben ernst und heiter zu nehmen, und zwar vor allem dort, wo ich urteile. Wo ich kein Bewusstsein davon habe, wie ich zu einem bestimmten Urteil komme, nehme ich es heiter und werde nicht auf diesem Urteil beharren. Mein bewusstes Urteilen aber nehme ich ernst, versuche die Art zu verstehen, wie es zustandekommt, stehle mich nicht aus der Verantwortung, will den Ursprung, mindestens den Zusammenhang des Zustandekommens ergründen. Das braucht Geduld, aber ich begründe dadurch eine Beziehung, eine Wechselseitigkeit zwischen mir und mir, zwischen Bewusstsein und Unbewusstem, zwischen mir persönlich und etwas, was in mir über mich hinausgeht.
Wie komme ich zu einem persönlichen Urteil, in dem zugleich eine von mir unabhängige Wahrheit zu Erscheinung kommt? Wie gelingt es mir, etwas so zu individualisieren, dass das Universelle zur Geltung kommt? Universalisieren, also verallgemeinern; und individualisieren, also wirklich persönlich auffassen; gewöhnlich fühlen wir individuell, denken wir universell; kann ich mein Fühlen universalisieren, mein Denken individualisieren? Beide finde ich vor – träumend das Fühlen, erwachend das Denken. Woher nur kommen sie?
«So entspringen Empfindung und Selbstbewusstsein völlig ohne Zutun des Subjekts. Und beider Ursprung liegt ebenso jenseits unseres Willens, als er jenseits unseres Erkenntniskreises liegt.» (19. Brief)
Dem empfindenden und selbstbewusst werdenden Wesen entstehen zwei Grenzen. Eine Grenze des Willens im Hinblick auf den Ursprung dieser beiden Phänomene und eine Erkenntnisgrenze im Hinblick auf den Willen. Es geht jedoch weiter: «Sind aber beide wirklich und hat der Mensch vermittelst der Empfindung die Erfahrung einer ganz bestimmten Existenz und hat er durch das Selbstbewusstsein die Erfahrung seiner absoluten Existenz gemacht, so werden mit ihren Gegenständen auch seine beiden Grundtriebe rege.» (Ebd.)
Selbstbewusstsein und Empfindungen gewinnen, sobald wir uns bewusst werden, dass ihr Erkennen nicht im Bereich unseres Willens liegt, und wir diesen Willen nicht erkennen können, eine eigene Triebkraft, eine Schubkraft.
«Der sinnliche Trieb erwacht mit der Erfahrung des Lebens, der vernünftige mit der Erfahrung des Gesetzes und jetzt erst, nachdem beide zum Dasein gekommen sind, ist seine Menschheit aufgebaut.» (Ebd.)
In dem Moment, wo der Mensch sich dieser beiden Triebe bewusst wird, wird er Teil einer Menschheit, die selbst durch diese beiden Qualitäten als eine einheitliche geworden und zu begreifen ist. «Bis dies geschehen ist, erfolgt alles in ihm nach dem Gesetz der Notwendigkeit; jetzt aber verlässt ihn die Hand der Natur und es ist seine Sache, die Menschheit zu behaupten, welche jene in ihm anlegte und eröffnete.» (Ebd.)
Der Mensch ist ein natürlicher Mensch in einer sich ihrer selbst bewusst werdenden Menschheit, bis er selbst nicht nur in seinem Leben bewusst wird, sondern auch in seinem Bewusstsein lebt.
«Sobald nämlich zwei entgegengesetzte Grundtriebe in ihm tätig sind, so verlieren beide ihre Nötigung. Und die Entgegensetzung zweier Notwendigkeiten gibt der Freiheit den Ursprung.» (Ebd.)
Spielen, um aufzuwachen
Das ist eine geistesgeschichtliche Wende, die bis heute – jetzt allerdings existenziell – ihr Erwachen sucht. Ihr individuell gewolltes Aufwachen aus einem Traum der Vernunft, in dem das Bewusstsein über das Leben herrscht, ohne es in sich erwachen zu lassen. Der einzelne Mensch träumt, selbst wenn er sich vernünftig und frei erscheint – «ein vernünftiges Tier» (24. Brief).
«Um aller Missdeutung vorzubeugen, bemerke ich, dass, so oft hier von Freiheit die Rede ist, nicht diejenige gemeint ist, die dem Menschen, als Intelligenz betrachtet, notwendig zukommt und ihm weder gegeben noch genommen werden kann, sondern diejenige, welche sich auf seine gemischte Natur gründet. Dadurch, dass der Mensch überhaupt nur vernünftig handelt, beweist er eine Freiheit der ersten Art; dadurch, dass er in den Schranken des Stoffes vernünftig und unter Gesetzen der Vernunft materiell handelt, beweist er eine Freiheit der zweiten Art.» (Ebd.)
Eine ästhetische Kultur, in der wir lernen zu spielen, führt uns an die Schwelle des Erwachens aus dem Traum virtualisierender Vernunft. Eine Lebenskunst, die aus dem Leben im Bewusstsein nichts in der Welt der Erscheinung gering achtet, sondern das Eigentliche mitten im Dasein, nicht jenseits entdeckt – beide vermögen «die Ausführbarkeit des Unendlichen in der Endlichkeit» (25. Brief) nicht nur zu denken, sondern zu wollen.
Dieses Wollen ist Entscheidung. Aus der ersten Freiheit wird eine Entscheidung zur zweiten möglich. Jene ist, diese ist frei.
Das kann nur das Ich – nicht ohne gegenseitige Ermutigung und Ermunterung, ernst und heiter, aus wechselseitigem Erkennen, das statt Korrigieren und Besserwissen aus idealistischen Überzeugungen zur ästhetischen Bedingung für Freiheit und Leben wird.
Dieser Text ist die Nachschrift eines Vortrags von Bodo von Plato, welchen er im September 2021 in der Freien Akadmie am Loipoldhof hielt.

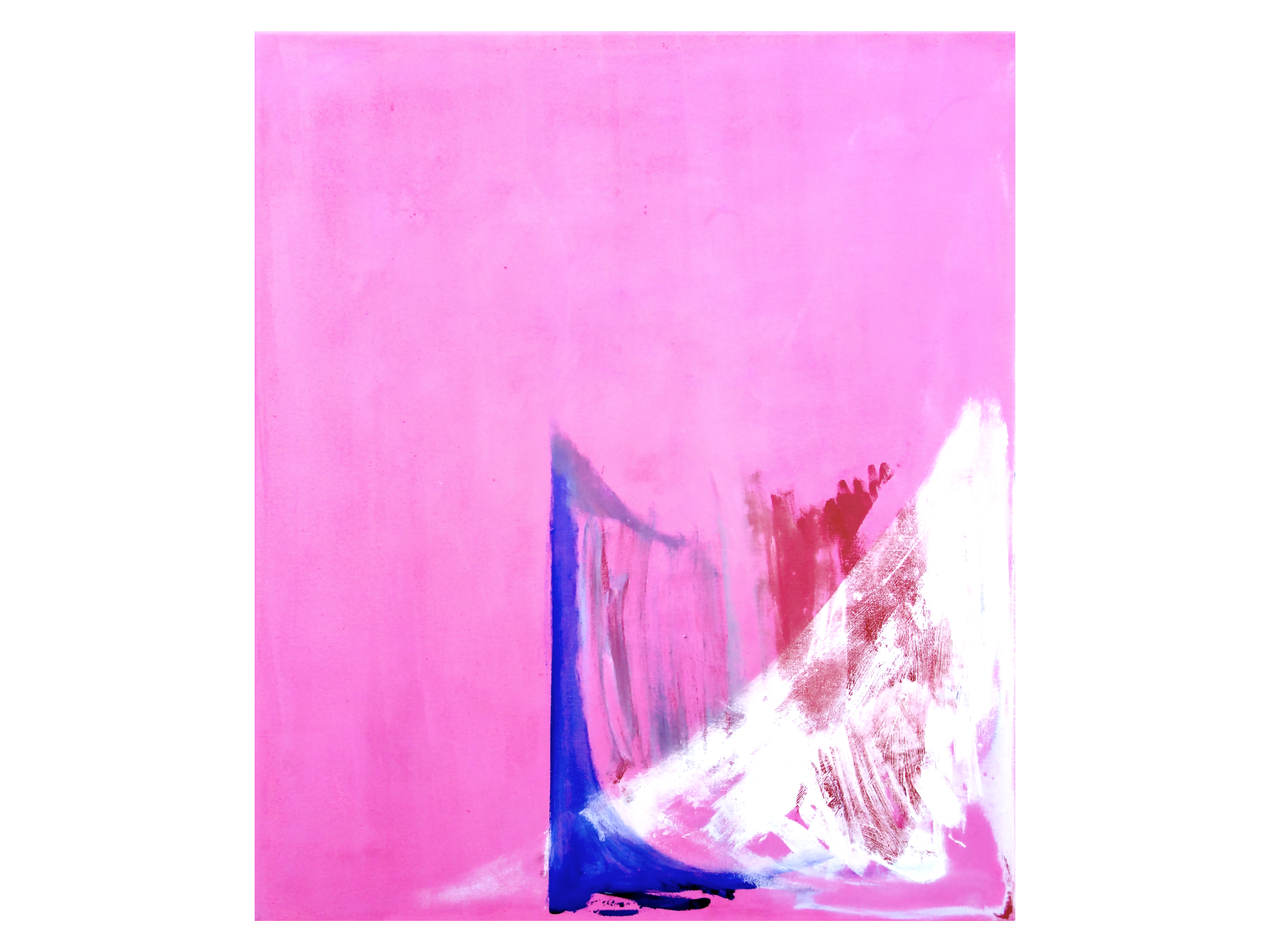








Lange kein so schönes Gedeck mehr gesehen,als wäre die Tafel vor langer Zeit bereitet,um auf
wundersame Weise,Heute daran Platz zu nehmen und gleichsam immer frische Speise zu genießen.G.