Christine Gruwez kennt den persischen Raum von vielen Reisen und Studien. Ein Gespräch über Geschichte und Perspektive in Afghanistan. Die Fragen stellte Wolfgang Held.
Christine Gruwez Ich schicke voraus, dass ich Afghanistan nicht besucht habe, dafür aber alle Nachbarländer, nicht nur den Iran, den ich ja viele Male besucht habe, sondern auch Turkmenistan, Tadschikistan, Pakistan. Dadurch ist mir die persische Landschaft und Kultur gut vertraut. Bis ins 18. Jahrhundert gehörten diese Gebiete ja alle zum Persischen Reich und teilten diese eine persische Kultur. Das gilt besonders für Afghanistan und den Iran, die kulturell eine Einheit bilden bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Aber all diese Länder haben gemeinsame Wurzeln, wie die Feuertempel des Zoroaster, des Zarathustra.
Was ist typisch für diese gebirgigen Landschaften des Hindukusch?
Das Licht! Es ist so charakteristisch, wie es über den Tag hin wirkt. Das lässt sich in keinem Foto einfangen. Wenn die Sonne hoch steht, ist das Licht messerscharf, und abends wird es unendlich weich und sanft. Da sieht man Violetttöne! In den tiefen Tälern schlängeln sich Flüsse mit türkisblauer Farbe.
Es überrascht nicht, dass dort die Religion des Lichtes war.
Natürlich. Die zweitgrößte ethnische Bevölkerungsgruppe, die Tadschiken im Norden, sind die Nachfahren der manichaischen Sogdiër, das manichäische Königreich der Sogdiana mit ihren Bischofsitzen in Samara und Bukhara, die jetzt in Usbekistan liegen. Nicht weit von dem jetzt viel besprochenen afghanischen Masar-e-Scharif in Balch ist Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, der bedeutendste persische Dichter des Mittelalters, geboren. Der Sufismus, die Mystik im Islam, hatte im Norden Afghanistans ein enormes Zentrum. Auch Avicenna oder arabisch Ibn Sina, der persische Arzt und große Aristoteles-Kommentator, stammt aus Bukhara.
Diese geistige Blüte unterschätzen wir, während gleichzeitig die Terrorgefahr aus Afghanistan überschätzt wird. Beim Anschlag vom 11. September gab es keinen einzigen afghanischen Terroristen, ja selbst heute sind international kaum Terroristen aus Afghanistan bekannt.
Das ist richtig. Weil die Taliban im eigentlichen Sinne keine Terroristen sind. Wenn man der Geschichte der Taliban-Guerilla nachgeht, dann sieht man, dass sie sich immer gegen Besatzer gewehrt haben. Ein Merkmal von Islamismus und Terrorismus ist, dass er international tätig und international vernetzt ist. Das Bestreben der Taliban beschränkt sich auf das eigene Land und zielt darauf, es von der Besatzung zu befreien, sei sie britisch, russisch oder – wie jetzt – amerikanisch.

Peter Scholl-Latour, der Südasienkenner, betonte, dass es für muslimische Gläubige unerträglich sei, bewaffnete ‹Ungläubige› im eigenen Land zu wissen.
Es ist unerträglich, dass da eine Macht aus dem Westen mit so völlig anderem Gesellschaftsbild ins Land kommt und meint, jetzt sollten alle ihr Welt- und Sozialbild übernehmen. Afghanistan ist ein tragisches Beispiel dieses Hochmutes, aber es ist nicht das einzige Beispiel. Zu der Unerträglichkeit gehört, dass die Taliban selbst nicht anerkannt werden, obwohl es in den letzten 20 Jahren Momente gab, wo sich dafür eine Tür geöffnet hatte. Auch in den Vereinten Nationen baten die Taliban um Anerkennung. Heute ist viel vom Pandschirgebirge die Rede und von den Kämpfen, die dort drohen. Achmed Massoud, der Mudschaheddin-Kämpfer, Widerstandsführer gegen die früheren Taliban, wurde ja zum afghanischen Nationalhelden erklärt. Auch er bemühte sich um die Anerkennung bei den Vereinten Nationen. Das wurde zurückgewiesen. Zwei Tage vor dem Attentat vom 11. September wurde er von Al-Kaida-Terroristen ermordet. Zwei Männer hatten sich als belgische Journalisten ausgegeben. Sie wollten nicht, dass diese Versöhnung mit dem Westen stattfindet. Wenn wir an den 11. September denken, so hat in Afghanistan der 9. September diese Gültigkeit. Tatsächlich wäre Massoud fähig gewesen, den Norden mit dem Süden, die tadschikische mit der paschtunischen Bevölkerung des Landes zu versöhnen.
Nach ihm, als die US-Truppen ins Land kamen, wandte sich der religiöse Führer der Taliban an die Vereinten Nationen mit der Bitte, ob die Taliban nicht in der UNO als Teil einer Regierung anerkannt werden könnten. Es gab Momente, wo man für die Einheit Afghanistans und die Integration in die Internationale Gemeinschaft etwas hätte tun können.
Es ist das Licht! Es ist so charakteristisch, wie es über den Tag hin wirkt. Das lässt sich in keinem Foto einfangen. Wenn die Sonne hoch steht, ist das Licht messerscharf, und abends wird es unendlich weich und sanft.
Es gibt bei den Taliban also einen gemäßigten Arm und einen, der zu den grausamen Übergriffen fähig ist?
Die Taliban haben sich ja aus den Befreiungskämpfern, den Mudschaheddin, gegen die russische Besatzung gebildet. Nach dem Abzug der Russen 1988 ist dann das erste Emirat in Afghanistan entstanden, das bis 2001 dauerte. In dieser Zeit regierten die Taliban bzw. die Mudschaheddin. Es gab in dieser Zeit auch einige Reformen. Der Süden und der Norden entzweiten sich dann jedoch und es kam an einzelnen Orten zu schrecklichen Gewalttaten, gleichwohl blieb es das vordringliche Motiv, jede Form von ausländischer Besatzungsmacht aus dem Land zu vertreiben. Was ich tragisch finde: Von 2000 bis vielleicht 2002 hat die afghanische Regierung unter ihrem damaligen Führer Mollah Omar eine Fatwa auf den Anbau und Handel mit Drogen ausgesprochen. Schon kurz nach dem Einmarsch der US-Truppen war mit diesem Bann Schluss. Die Zusammenarbeit mit den Warlords und der Wunsch, die Drogen nach Russland zu exportieren, ließen den Anbau wieder in die Höhe schnellen. Jetzt liefert der afghanische Mohnanbau über 80 Prozent des weltweiten Marktes.
Francis Fukuyamas Idee vom ‹Ende der Geschichte› – es laufe überall darauf hinaus, dass man das europäische Gesellschaftsmodell verwirkliche – hat sich als große Illusion erwiesen.
Es ist erstaunlich, dass die afghanische Gesellschaft im 20. Jahrhundert mindestens dreimal versuchte, sich eine Verfassung zu geben. Das geschah recht parallel zum Iran. Auch ist wenig bekannt, dass es im Iran eine Verfassung gibt, die eine Demokratie ermöglicht. Das war 1906, und sowohl die britische als auch die russische Politik hat zu verhindern versucht, dass es über diese Verfassung eine Abstimmung gibt. Gleichwohl wirkt diese Verfassung bis heute nach und in Afghanistan sind die Verhältnisse sehr ähnlich. Bis 1996 hatte Afghanistan noch einen König, der von den Briten eingesetzt wurde. Es gibt wie im Iran alle vier Jahre Wahlen.
Wobei viele ja nicht als Kandidaten zugelassen werden.
Ja, die Demokratie ist eingeschränkt, aber formell ist es eine Demokratie, auch mit zwei Kammern, wobei in beiden Kammern ein bestimmter Prozentsatz vom Klerus eingesetzt wird. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir in Europa eine Demokratie haben, die auch ihre Schwächen und Grenzen hat.
Gibt es also eine afghanische demokratische Kultur?
Ja, ‹demokratisch› im alten Sinne, vor allem auf Stammesebene, wenn die Stammesältesten zusammenkommen und über lokale politische Fragen abstimmen. Aber was heißt eigentlich ‹demokratisch›? Die Form alleine genügt ja nicht. Es geht auf jeden Fall um die Frage, ob die Bevölkerung in irgendeiner Form mitbestimmen kann, und das hängt eminent von der Bildung im Land ab. Hier war es eine Illusion des Westens, unsere gesellschaftlichen und politischen Ideen in ein Land mit einer so eigenen Geschichte und Kultur hineinzudrücken. Das mag äußerlich gelingen, aber innerlich sind die nötigen Entwicklungen noch nicht geschehen.
Welche Rolle spielt die hohe Analphabetenquote in Afghanistan, 80 Prozent bei Frauen und 50 Prozent bei Männern?
Ja, wichtig ist, dass es auch für die Männer gilt. Ich sehe darin, dass noch sehr viel aus dem alten indischen Kastensystem nachwirkt. Durch den Islam ist dieses alte hierarchische Denken zwar zurückgedrängt worden, denn im Islam ist jeder Mensch gleich, und doch wirkt es noch fort. Das zeigt mir, wie mächtig dieses Kastenwesen einmal gewesen ist und teilweise noch ist. Hinzu kommt die enorme Kluft zwischen Stadt und Land. Die Gebildeten leben in den Städten. Herat ist eine Stadt mit einer traditionsreichen Universität, mit Bibliotheken und viel Bildung. Kabul ist dagegen weniger kulturell gebildet, hier ist die Nachahmung des Westens stärker. Kommt man dann aufs Land, wird das Leben einfach und man muss hart arbeiten, um eine Familie ernähren zu können. Für diese Menschen ist es schwer, an dem gesellschaftlichen Aufbruch teilzunehmen.

Im Iran, aber auch in Afghanistan hat sich die Geburtenrate in den letzten 40 Jahren halbiert. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass die Bildung der Frauen steigt. Sind sie der Schlüssel für die Zukunft?
Ja, die Frauen emanzipieren sich. Das geschieht auf zwei Arten: die Nachahmung des Westens in den sozialen Medien und im Konsum. Die andere Art heißt Schule und Studium! Es ist im Iran das große Glück, dass jede Person studieren kann, was sie will und so lange sie will. Es wird staatlich finanziert. Die meisten Frauen in Afghanistan oder im Iran studieren dann Medizin oder Jura. Von ihnen hängt in den nächsten Jahren viel ab, wie auch von den Männern, die sich bilden möchten, aber es sich nicht leisten können, weil sie der unteren Schicht angehören.
Wie kann der Westen die Entwicklung in Afghanistan unterstützen?
Der Westen kann da gar nichts unterstützen. Er hat dort nichts zu tun. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das Engagement der letzten 20 Jahre dort sollte. Was tun wir da? Diese Kultur hat ihre eigenen Schritte zu gehen, in ihrer Art und Weise, in ihrem Tempo. Vielleicht wird es noch ein Jahrhundert dauern, bis sie dort sind, wo wir glauben, dass wir uns jetzt befinden – aber es wird auf ihre Art und Weise geschehen müssen. Demokratie baut doch auf der Würde und der Gleichheit der Menschen. Wenn nun jemand kommt, der zu wissen meint, wie du werden sollst, dann widerspricht das dieser zutiefst demokratischen Idee. Schauen wir auf Länder, die auch mit der westlichen Besatzung zu tun hatten, wie Algerien oder Ägypten. Was tun die ersten Menschen in der Bevölkerung, die in Genuss der Segnungen der Bildung kommen? Sie wenden sich gegen die Besatzung! Dieser Übergriff des Westens hat dem Islamismus den Boden bereitet, wie beispielsweise bei der Muslimbruderschaft in Ägypten. Sie studierten und fragten sich dann: «Was tut der Westen hier?» Sie wurden von den Besatzern verfolgt und eingekerkert. In Algerien war es Abd el-Kader, der aus der französischen Gefangenschaft Briefe schrieb, die dann die Grundlage für terroristische Bewegungen bildeten.
Die Hilfe des Westens hat sich – und sei es unbewusst – heute noch nicht von den Gedanken der Kolonialzeit befreit.
Ist der Terrorismus ein Echo der Kolonialzeit?
Das ist nicht einfach zu sagen. Auf jeden Fall hat sich die Hilfe des Westens – und sei es unbewusst – heute noch nicht von den Gedanken der Kolonialzeit befreit. Es ist ja auch ein christlicher Gedanke, dass wir unseren Wohlstand und unsere Freiheit, die wir im Kapitalismus erreicht haben, teilen wollen. Aber nicht auferlegen! Es ist auch christlich, zu denken, dass der Mitmensch in sich die Würde trägt, aus der er selbst entscheiden kann.
Helmut Schmidt sagte in einem Interview, es bleibe keinem Muslim, keiner Muslima verborgen, dass wir mit unserem christlichen Hintergrund bezüglich Individualisierung und Aufklärung auf die Religion des Islam hinunterschauen.
Ja, das spürt jeder – auch diejenigen, die hier mitten unter uns leben.
Wie überwinden wir diesen Hochmut?
Rudolf Steiner und mit ihm viele spirituelle Lehrer und Lehrerinnen betonen, dass Demut das Tor zum Geist ist. Also ist es der Hochmut, der diesen Weg verschließt. Das gilt dabei gleichermaßen für die so Gedemütigten wie für all jene, die in diesem Hochmut gefangen sind – es schließt ab. Man meint, dass man selbst doch einige Schritte weiter sei, und bemerkt nicht, wie er oder sie sich durch den Hochmut aus der Mitmenschlichkeit verabschiedet hat. Ich habe so viele Reisen in den persischen Raum und den Nahen Osten gemacht, etwa in den Libanon oder nach Syrien, mit Gruppen aus Deutschland, der Schweiz oder den Niederlanden. Dann sieht man erstmals Menschen am Straßenrand niederknien und beten und sagt oder denkt: «Was machen die da auf dem Boden?» In einer Moschee war jemand darüber irritiert, dass alle Uhren stillstehen und scheinbar kaputt sind. Er wusste nicht, dass die Uhren die Gebetszeit angeben und jeweils angepasst werden. Man stellt verblüfft fest, dass es in einem iranischen Haushalt einen Staubsauger gibt. Oder wenn man zu Gast ist: «Du hast hier ja eine richtige Küche!» Das klingt ganz unschuldig und ist doch ein Schattenwurf unseres Hochmutes.
Um eine Menschheit zu werden, müssen wir es mit diesem Hochmut aufnehmen – oder? Wie hast du ihn verwandelt?
Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich ertappe mich noch oft, zum Beispiel wenn ich ein bestimmtes Buch in einer Bibliothek will und mir da ein Mensch aus Schwarzafrika gegenübersteht und ich denke, dass er es bestimmt nicht findet. Ich kämpfe damit, jeden Tag.
Mahmud Erol Kiliç, Professor für Sufismus in Konja, Türkei, betonte in einer Veranstaltung am Goetheanum, dass man als Muslim oder Muslima mit der Schwierigkeit lebe, in Europa das Christentum nicht zu finden. Man wolle Brücken bauen und finde kein religiöses Gegenüber, sondern Materialismus und Konsumismus.
Seit Jahrzehnten frage ich mich, wie wir einander finden – nicht nur zwischen Christentum und Islam, aber hier brennt die Frage am stärksten. Ich spüre die Sehnsucht in den anderen Religionen nach dem Christlichen. Ich war einmal mit einer hochgebildeten pakistanischen Frau in Chartres. Ich hatte mich gut vorbereitet, um ihr alles zu zeigen und zu erklären. So gingen wir durch die Kathedrale. Da fragte sie mich: «Wo kann man hier beten?» Sie war Direktorin der Kunstakademie in Lahore. Sie setzte sich hin und fing an zu beten. Für sie ist Chartres ein Gotteshaus, und da betet man.

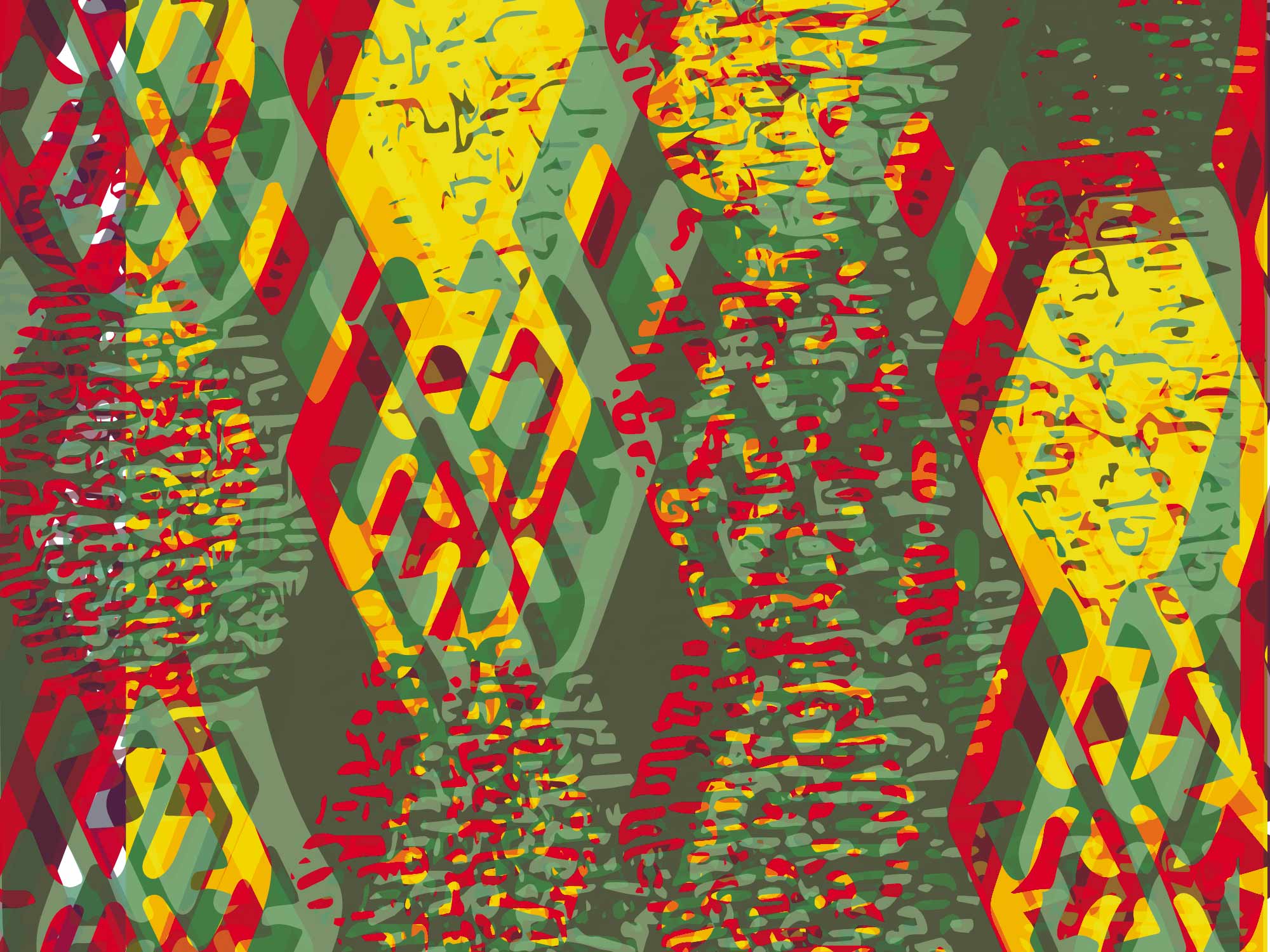








„Ich war einmal mit einer hochgebildeten pakistanischen Frau in Chartres. Ich hatte mich gut vorbereitet, um ihr alles zu zeigen und zu erklären. So gingen wir durch die Kathedrale. Da fragte sie mich: «Wo kann man hier beten?» Sie war Direktorin der Kunstakademie in Lahore. Sie setzte sich hin und fing an zu beten. Für sie ist Chartres ein Gotteshaus, und da betet man.“
Wer das liest und wem dann nicht die Schamröte ins Gesicht steigt und wer sich dann nicht heimlich aus der Runde stiehlt, dem sei der Vers aus dem Schillergedicht an die Freude in Erinnerung gerufen:
„Ja – wer auch nur e i n e Seele
s e i n nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund!“
Es kommen mir die Tränen, wenn ich daran denke, wie leer unsere Kirchen sind und kaum sind Betende zu sehen! Wer weiß denn noch auf den Knien zu beten? Wenigstens in den katholischen Kirchen bekommt man es zu sehen. Man würde es ja selbst gerne tun, aber man traut sich nicht, weil es nie gelehrt wurde, jedenfalls nicht in meinem protestantischen Konfirmationsunterricht. Jetzt ist man alt geworden und muss endlich das Beten lernen, von dem frommen Muslimen, wie der türkische Gastarbeiter, der unseren Garten bearbeitete, und der zu seinen Zeiten seinen Gebetsteppich im Garten ausbreitete und seine Gebete verrichtete. Ich beneidete ihn regelrecht oder den Mitstudenten in der Mensa, der vor dem Beginn des Essens still für sich sein Tischgebet verrichtete! Das war bei uns noch Sitte in meiner Kindheit, dass die Tischgesellschaft von oft 14 Personen immer erst mit dem Essen beginnen konnte, wenn das Tischgebet gesprochen worden war. Im Internat in der Waldorfschule war das auch üblich. Wenn alle diejenigen, die heute kaum noch von ihrem Smartphone aufblicken, wenn sie den Weg entlang gehen oder während des Essens in der Gastwirtschaft so vor sich hin wischen, und gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich essen. Wir sind alle ganz schreckliche Materialisten! Wenn wir das Beten nicht wieder lernen in der Not, dann ist doch alles vergebens
Gerhardus Lang, Bad Boll