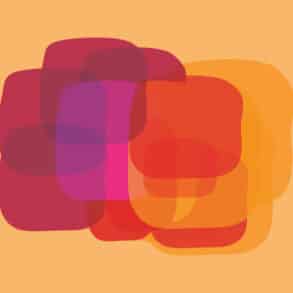Im Gespräch über Sprache und menschliche Gemeinschaft mit Sonja Zausch, Eurythmistin, Sozialunternehmerin und Mitglied im Leitungstrio der Sektion für Heilpädagogik und inklusive soziale Entwicklung und Sven Saar, Pädagoge, Seminarleiter und Vortragender zur Waldorfpädagogik. Die Fragen stellte Wolfgang Held.
Welche Rolle spielt Sprache für unser Miteinander?
Sonja Zausch Für mich, als jemand, die sich viel um Inklusion in der Gesellschaft bemüht mit dem Blick auf marginalisierte Gruppen, ist der Umgang mit Sprache die Eingangstür in eine demokratische Gesellschaft. Wenn ich mich nicht eingeladen fühle, weil ich sprachlich nicht berücksichtigt werde, werde ich am Miteinander nicht teilnehmen und auch nicht teilgeben.
Gab es ein Erlebnis für dich, das dich hier sensibilisiert hat?
Zausch Es ist mein Alltag. Wenn ich mit Menschen mit Assistenzbedarf zusammen bin, merke ich, wie viel Kraft oder Konzentration ich brauche, um aufmerksam zu sein, alle teilhaben zu lassen, und der erste Schritt geschieht eben über die Sprache, meine ich.
Sven Saar Die Sprache erlebe ich als Spiegel unserer Zeit. Hätte es die Anthroposophische Gesellschaft vor 300 Jahren gegeben, so hätte man die Anwesenden begrüßt mit «Sehr geehrte Herren!» Im Saal hätten nur Männer gesessen, denn Frauen wäre damals der Zutritt verwehrt gewesen. Hätte die Versammlung vor 100 Jahren stattgefunden, so hätte man sie wohl begrüßt mit «Sehr geehrte Damen und Herren», weil auch Frauen im Saal saßen. Wenn ich jetzt aber, im Jahr 2024, auf der Bühne stehe und sage: «Liebe Freunde», dann spreche ich damit explizit nur die Männer an, dabei sind drei Viertel der Anwesenden Frauen. Das bedeutet dann, dass ich sie damit genauso ausschließe, als wenn ich von «Herren» sprechen würde. Das beginnt sich zu ändern.
Gibt es nicht Bewegungen in der Sprache, wo das von selbst geschieht, sodass die Sprache sich von alleine transformiert? Ich nehme das Beispiel Frau und Fräulein.
Saar Darf ich energisch widersprechen? Das ist keine Veränderung, die von selbst geschehen ist. Dafür und für ihre Gleichberechtigung haben sich Generationen von Frauen eingesetzt, sind auf die Straße gegangen. Manche sind für diese Sache gestorben.
Zausch Das Interessante ist an dem Beispiel, dass dahinter ja Biografisches steht. Die verheiratete Frau oder die nicht verheiratete Frau, das sind ganz verschiedene Lebenskonzepte, wobei ich in der Bezeichnung ‹Fräulein› für Unverheiratete etwas Diskriminierendes und Wertendes erlebe, weil sie mit diesem Diminutiv verkleinert wird.

Geschieht im Englischen nicht etwas Ähnliches, wenn ‹actor› auch für Schauspielerinnen verwendet wird und Maggie Thatcher mit ‹Prime Minister› tituliert wird? Die männliche Form wird zum geschlechtslosen Begriff erweitert?
Saar Im Englischen gibt es keine gegenderten Artikel. Wenn ich auf Englisch ‹teacher› sage, ist es dir völlig freigestellt, ob du einen Mann, eine Frau oder einen diversen Menschen vor deinem inneren Auge hast. Diese Freiheit hast du im Deutschen nicht.
Zausch Wir müssen erst einmal alle Diversität der Individuen benennen. Dann können wir vielleicht auch etwas im Konsens wieder zusammenfügen.
Saar Deswegen betone ich gerne meine Vermutung, dass wir in einer Übergangszeit sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein- bis zweihundert Jahren die gendernden Artikel aus der deutschen Sprache abgeschafft haben. Da kann der Hörende sich sein eigenes Bild machen und das Bild wird nicht vorgeformt. Die romanischen und germanischen Sprachen zum Beispiel erlauben das bisher nicht. Sie sind historisch – pa-triarchalisch gegendert, weil in ihnen die männliche Form der Standard ist. Wir gendern also nicht, wenn wir Lehrer*innen sagen, wir entgendern. Dadurch öffnen wir etwas, das bisher geschlossen war.
Zausch Kürzlich war an einer Tagung von einer ‹blinden Frau› die Rede, obwohl ihr Blindsein für den Sachverhalt, um den es ging, gar keine Rolle spielte. Ich bringe jemanden in Distanz zu mir und dadurch identifiziere ich ihn durch sein Anderssein, das ‹Othering›. Manchmal freue ich mich, etwas als Frau zu sagen, wenn mich aber jemand fragt, was ich ‹als Frau› dazu meine, dann ist das wie der eben beschriebene Fall. Wir sehen, es hängt davon ab, aus welcher Haltung jemand spricht. Fragst du, um zu betonen, dass ich anders bin, geht es um Macht und Bewertung, nicht um Interesse.
Es gibt den Einspruch: Die weibliche Form schreibe auf die Geschlechtlichkeit fest. Ich werde genötigt, meine Weiblichkeit als Information mitzuliefern. Man will eine diskriminierende Praxis bekämpfen und diskriminiert von Neuem – oder?
Zausch Ich bin so froh, wenn ich inzwischen nach 55 Jahren mutig sagen darf: «Ich bin eine Frau», weil ich das selber verstanden habe. Da geht es nämlich noch um einen anderen Schritt. Wie schaffe ich die Selbsterkenntnis meiner Geschlechtlichkeit? Das ist ein aufwendiger, zutiefst intimer Weg. Ich ziele mit meiner Frage auf die weiblichen Kritikerinnen des De-Genderns. Ich vermute, dass sie sich zu wenig damit beschäftigt haben, was Geschlechtlichkeit bedeutet und wie exkludiert sie aufgrund ihres Geschlechts werden.
Saar Darf ich dir anbieten, das ein bisschen abzumildern? Das ist sicher für manche Frauen so, wie du es sagst, aber nicht für alle. Meine Frau sagt mir, sie könne damit leben, dass von ihr als ‹Übersetzer› gesprochen wird, denn sie bezeichnet sich auch selbst so, in Anlehnung an das englische «actor», das auch inzwischen für alle Geschlechter gilt. Sie ist dann ein moderner Mensch, der sich stark genug fühlt in seiner Individualität, diese Entscheidung für sich zu treffen.
Zausch … und der das auch will.
Saar Genau. Deswegen freue ich mich, wenn wir hier nicht von ‹müssen› sprechen, sondern von ‹dürfen›. Nach meinen Vorträgen über dieses Thema gibt es meist eine Aussprache. Da ist fast immer jemand im Publikum, der sagt: «Jetzt darf ich dies und jenes nicht mehr sagen und muss ganz anders sprechen!» Und da sage ich: «Nein, niemand muss, aber ich darf, wenn ich will.» Für mich ist das ein Entwicklungsangebot. Der Mensch als sich entwickelndes, werdendes Wesen hat auf einmal eine neue Palette zur Verfügung. Ich kann mir diesen Glottisschlag angewöhnen. Das Wort ‹Lehrer*innen›ist holprig und immer ein bisschen schwierig. Ich verlange jedoch keinesfalls von dir, dass du so redest. Das ist mein eigener Entwicklungsweg. Und als Anthroposoph freue ich mich, ein neues Entwicklungsfeld gefunden zu haben.
Es gibt ja Worte, wo dieser Stopp selbstverständlich ist: zum Beispiel Spiegelei oder Theater.
Saar Und Reinkarnation. Ja, und ich mache das Entgendern besonders bewusst, weil ich eher selten Deutsch spreche. Und jedes Mal, wenn es mir gelingt, freue ich mich, und wenn es mir durchrutscht, ärgere ich mich. Das ist meine Privatsache.
Welche Reaktionen begegnen dir?
Saar Im Großen und Ganzen positive. Ich habe im vergangenen Jahr in über 20 Waldorfschulen zu diesem Thema Fortbildungen, Vorträge und Oberstufenworkshops gegeben. Da gibt es regelmäßig ein oder zwei Menschen, die sich durch das Thema angegriffen fühlen und sagen, sie müssen jetzt gegen diesen Totalitarismus einer neuen Sprachwahl kämpfen. Aber die große Mehrheit der Menschen hat kein Problem damit.
Zausch Die Frage, die wir doch stellen können, ist: Wer soll sich verändern? Das haben wir bei dem Thema Inklusion auch. Also die Person mit Assistenzbedarf hat keine Mühe damit zu sagen: Ich möchte inkludiert werden in die Gesellschaft. Sie steigt in den nächsten Bus und sagt: Los gehts. Der/die Busfahrer*in hat die Schwierigkeit, dass er/sie mehr Zeit braucht, bis die Person mit Assistenzbedarf eingestiegen ist, die Fahrkarte gekauft und einen Platz gefunden hat. Wir sind in der Pflicht, Veränderung zuzulassen. Nicht die diversen Menschen, die haben ja schon ihren Prozess ausführlich gemacht, damit sie gut und authentischer leben können. Jetzt müssen die Übrigen Bereitschaft zeigen und hierzu ermutige ich.
Saar Ich würde gern kurz auf das auf das Thema eingehen, das an der vergangenen Weihnachtstagung am Goetheanum betont wurde: Zuhören als Fähigkeit der Begegnung und Gesprächsführung. Ich vermute, dass hier wenig Fortschritt möglich ist, solange ich Sprache zum Senden verwende und nicht zum Empfangen. Viele Rednerinnen sprechen einfach und die Rezeption ist dann Sache des Publikums. Eigentlich sollte ich, bevor ich spreche, überlegen: Wer hört mir zu, und wie erreiche ich diesen Menschen? Für Lehrer*innen ist das selbstverständlich und sollte auch für Vortragende gelten.
Zausch Es gab auch eine andere Formulierung an der Tagung, die mir auffiel. Da wird gesagt: «Sie kennen das ja alle.» Das finde ich eigenartig, denn ich weiß ganz viel nicht. Auch solch ein Satz ist Exklusion. Da herrscht noch wenig Bewusstsein dafür, wie ein gemeinschaftliches Verständnis zu einem Thema entsteht.
Saar Ich hatte vor ein paar Jahren ein Damaskuserlebnis. Ich gebe regelmäßig für meine Studierenden einen Kurs ‹Equality and Diversity›, wo es um Rassismusbekämpfung geht. Am Anfang der Pandemie bat mich der Vorstand der südafrikanischen Waldorfschulbewegung um ein Onlineseminar zu diesem Thema. Ich habe erst gedacht, die meinen das ironisch, weil sie gehört haben, dass ich als weißer Mitteleuropäer über Rassismus spreche. Die sagten aber: «Nein, nein, wir wollen das von dir.» Dann habe ich mich online mit zwei Lehrer*innen von dort getroffen, eine weiß, eine schwarz, und habe noch einmal gefragt: «Warum wollt ihr von mir als deutschem älteren Mann, dass ich euch in Südafrika etwas über Rassismus erzähle?» Und dann hat die schwarze von den beiden Frauen geantwortet: «Weißt du, seit über 100 Jahren versuchen wir euch beizubringen, dass Rassismus nicht ‹unser› Problem ist.»
Zausch Das ist interessant.
Saar Ja, mir wurde dadurch klar, dass ich davon ausging, dass sich Leute in Rollstühlen über fehlende Rampen an Gebäuden beschweren, bevor sich etwas ändert. Dabei ist das gar nicht ihre Aufgabe. Und dieses Prizip ist direkt übertragbar auf Sexismus und Rassismus. Der amerikanische Politiker Pete Buttigieg betont den Unterschied zwischen nicht rassistisch und antirassistisch: Nicht Rassist zu sein bedeute, Rassismus zu vermeiden, Antirassismus, sich gegen den Rassismus zu stellen.
Saar Weil ich international viel unterwegs bin, sehe ich, dass uns andere Kulturen dabei noch weit voraus sind. In den Statements der San Francisco Waldorf School zum Beispiel finde ich mich wieder. Der Bund der Waldorfschulen und die ‹Erziehungskunst› sind in diesem Bereich auch vorbildhaft aktiv.
So sehr es gilt, sich in andere hineinzuversetzen, so wichtig scheint es zu sein, aus sich selbst heraus persönlich zu sprechen.
Zausch Ja, wir sind aber heute an einem Punkt, wo wir von niemandem mehr etwas annehmen möchten, das nicht mit sich selber in Verbindung gebracht ist. Es geht um diese persönliche Brücke, die eigene Erfahrung. Da wünsche ich mir, dass wir Scham abbauen, um uns gegenseitig von uns selbst erzählen zu können.
Saar Wir zitieren gerne Joseph Beuys: «Zeige deine Wunde.» Jemand, der viele Wunden erfahren hat, der Person of Color ist oder als Frau diskriminiert wurde, ist diese Person. Wenn diese Person ihre Wunde zeigt, dann bringt uns das alle ein Stück weiter. Aber was machen wir mit privilegierten und daher empathiebehinderten Menschen, die denken, sie hätten keine Wunden? Leute wie Sven Saar und Wolfgang Held? Ich bin Menschen wie Sonja, wie meinem schwarzen Enkelsohn und allen möglichen Menschen dankbar, dass sie mir zeigen, wie viel ich noch zu lernen habe.
Zausch Das darf mich verletzen, ohne dass es mir peinlich ist. Es gab eine Situation bei den Gesprächen zur zwölften Sektion. Da hat mir ein Kollege eine Frage gestellt, die ich konfrontativ fand. Ich habe dann gesagt: «Es tut mir leid, ich kann da jetzt im Moment nicht drauf antworten, das ist mir zu viel.» Und er hat sich hinterher bei mir entschuldigt und ich habe gesagt: «Du musst dich nicht entschuldigen. Ich fand das in Ordnung, dass du die Frage gestellt hast. Das war aus deiner Perspektive eine richtige Frage. Nur für mich war sie zu viel und ich bin zum Glück Frau genug, dass ich sagen konnte, ich kann das gerade nicht beantworten, und ich kam nicht ins Stottern und Rechtfertigen, denn das ist ja etwas, was Frauen auch sehr gut können. Wenn ich möchte, dass alle den Prozess verstehen, dann muss ich mich aussprechen.
Saar Das ist, wie wenn ich so einen Stolperstein auf der Straße sehe, da falle ich ja nicht wirklich auf die Nase. Der fällt mir nur auf, weil er ein bisschen heraussteht. So sehe ich das auch mit der Sprachangleichung, die viele von uns im Moment ganz bewusst vornehmen, für die wir uns auch nicht entschuldigen. Wir machen das dann so lange, bis uns etwas Besseres einfällt.
Zausch Es geht nur um etwas Besseres, also darum, einen guten Willen zu zeigen. Es geht hier überhaupt nicht darum, jemanden erneut zu diskriminieren, sondern nur darum, zu sagen: Wir wollen, dass alle Menschen gesehen werden. Das ist doch das einfachste Menschenrecht der Welt.
Saar Mich haben die Zeilen von Hilde Domin berührt, mit denen die Eurythmieaufführung ‹Wegspuren› anfängt: «Wir können keinen Weg dauerhaft gehen und im Gehen gleichzeitig von oben aus der weiten dahinschwebenden Luft der Vögel auf uns selbst sehen. Wir müssen manchmal aufbrechen, ohne zu denken. Der Aufbruch muss die Regie über das Ziel und den Blick auf unsere Füße übernehmen.»
Wo seht ihr in der Anthroposophie hier Baustellen?
Zausch Da gibt es viele Wörter, über die ein vermeintliches Verständnis von etwas herrscht, worüber aber wenig gesprochen wird. Ein Beispiel aus meinem Feld, der Eurythmie: Wir reden von ‹Wochensprüchen›, aber was meinen wir damit? Was sind denn die Wochensprüche für dich? Das ist das Büchlein, das ist der Spruch, das sind die schweren Wörter, das sind die Formen für die Eurythmie, das sind die Farben, der Schleier – das alles ist ‹Wochenspruch›. Das ist eben diese Fachsprache, die mehr abgrenzt als einzuladen.
Saar Sonja hat mit vielen Fragen geantwortet. Und hier ist meine Antwort auf deine Frage: gemeinsam zu fragen und so zu öffnen. Wie siehst du das? Wie kommt das bei dir an? Darum geht es. Wir leben im zweiten Jahrhundert der Anthroposophie und haben eigentlich genug Übung darin, schlaue Sachen zu sagen. Hören wir auf zu senden und beginnen zu empfangen.
Zausch Das Wort ‹Ich-Botschaften› ist ja etwas verbraucht, und doch ist es heute der Königsweg, eigentlich die einzige Chance. Ich kann nur von mir sprechen. Es gibt diese Deutung, dass es egoistisch sei, von sich selbst zu sprechen, weil man sich damit zu wichtig nehme. Das Gegenteil ist aber der Fall. Indem ich von mir spreche, mache ich mich nicht zum objektiven Maßstab, maße mir nicht an, für alle Gültigkeit zu repräsentieren.
Saar In einer Fortbildung habe ich mit dem Kollegium an einer inklusiven Version des Märchens ‹Rapunzel› gearbeitet. Hier hat Rapunzel zwei Mütter, ist ein Junge und heiratet doch am Ende den Prinzen. Ich bitte die Teilnehmenden, beim Zuhören gut auf ihre intuitiven Reaktionen zu achten, als Wahrnehmungsübung. Dann sagt ein Lehrer, dass dies die Errungenschaften der Geisteswissenschaft durch den Dreck ziehe. Eine Kollegin meldet sich und widerspricht, ein Dritter stimmt ihr zu. Ein Vierter sagt: Also, wenn man mal zur Goethe zurückgehen und auf das Männer- und Frauenbild schauen würde … Und schon ist eine kontroverse, recht hitzige Diskussion im Gange. Nach zehn Minuten meldet sich ein junger Mann, der bis jetzt im ganzen Seminar geschwiegen hat und sagt: «Ich will euch von meinen Bruder erzählen. Wir waren beide auf der Waldorfschule, und er ist schwul und hätte sich total gefreut, wenn jemand einmal dieses Märchen so erzählt hätte.»
Zausch Und damit ist Ruhe.
Saar Damit war die Sache beendet, weil jeder verstanden hatte, worum es ging. Die anderen haben gedacht, sie wären in einer Talkshow, und dieser Lehrer hat aus dem Leben gesprochen. Das ist ja das Anliegen, dieser Mensch, der seine ganze Waldorfschulzeit damit verbracht hat, unsichtbar zu sein, weil es im Waldorflehrplan keine Homosexualität gibt. Mit solch einer Geschichte wäre er für einen Moment gesehen worden.
Zausch Ja, das ist es, was wir uns schenken: gesehen zu werden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Titelbild Sonja Zausch im Gespräch, Foto: W. Held