Freundlichkeit ist keine moralische Forderung, sondern eine absichtslose Kunst. Sie öffnet Türen zwischen Menschen, ohne etwas zu erwarten. Sie ist ein Schulungsweg, der mitten durch den Alltag verläuft.
Der spirituell unterschätzte und auch die eigene Spiritualität unterschätzende Dramatiker und Dichter Bertolt Brecht (1898–1956) stellte in seinem Gedicht ‹Vergnügungen›1 einmal das ‹Freundlich sein› neben Dinge wie Bücher lesen, Singen oder gutes Essen. Auch in anderen Texten vertrat er die Auffassung, dass freundliches Verhalten nicht nur für den, dem die Freundlichkeit gilt, schön ist, sondern auch für den Freundlichen einen Gewinn darstellt. So konstatierte Brecht in einem Gedicht über die chinesische Holzmaske eines bösen Dämons, es sei «anstrengend […], böse zu sein»2.
Die Tugend der Freundlichkeit zielt letztlich auf die Willensschicht in der menschlichen Seele. Auch wenn ich in meinem Denken etwa die Meinung eines anderen skeptisch sehe, kann ich mir vornehmen, freundlich zu ihm zu sein. Auch wenn ich selber im Gemüt nicht in einer Stimmung der Heiterkeit bin und mein Gefühl nicht mit jemandem sympathisiert, kann ich durch Freundlichkeit eine zwischenmenschlich positive Atmosphäre herstellen. Beides ‹kann› ich zwar nicht unmittelbar aus meinem Sosein heraus. Aber ich kann es wollen. Ich kann versuchen, freundlich zu sein – weil sich die Qualität und Geste der Freundlichkeit im geheimnisvollen Zwischenbereich der Freiheit bewegt.
Sie ist wie eine Tür, die ich öffne und die offen bleibt für jeden und jede. Sie ist nicht das, was davor war oder dahinter liegt. Die Freundlichkeit schafft einen Zugang. Sie lässt Ich und Ich auf eine Weise begegnen, die Gespräch ermöglicht.
Ist Freundlichkeit, diese anmutige Mischung aus Distanz und Nähe, aus Leichtigkeit und ruhigem Ernst, die vielleicht nötigste Grundhaltung der Gegenwart? Sind hingegen Empathie, Achtsamkeit oder Wertschätzung nicht oft ‹etwas drüber›? Ist ihnen nicht mitunter etwas sanft Zwingendes, moralisch Forderndes und in manchen Augen auch zu sehr Gewolltes, ja Süßliches eigen? Die Freundlichkeit als solche will nichts, sie ist keine latent sittliche Erwartung. Sie ist eine Ermöglicherin. Sie will nichts aussagen über den Wert eines anderen Menschen, auch nicht positiv. Sie tut es nicht demonstrativ. Freundlichkeit ist absichtslos. Sie ist eine Künstlerin.
Natürlich kann auch die Freundlichkeit heuchlerisch und hohl werden, vorgeschoben und äußerlich, und gleichsam kippen in die bloße Konvention. Sie mag zur formalen Höflichkeit erstarren und dabei als Tugend sogar diskutabel werden: Sollen oder dürfen Männer heute einer Frau noch die Tür aufhalten?, Ist Höflichkeit heute noch ein relevanter Wert? Die Freundlichkeit im eigentlichen Sinne würde in dieser Weise keinen Pro-und-contra-Diskurs provozieren. Auf Freundlichkeit können sich alle einigen. Kurioserweise auch sich feindlich gegenüberstehende parlamentarische Lager: Dieselben, die sie im Ton eher vermissen lassen, empfinden hinterher die strukturellen Sanktionen durch die anderen als unfreundlichen Akt. Abseits solch rituellen Geplänkels markiert jedoch erst Herzlichkeit eine echte Grenze. Herzlich sein zu jemandem, der beispielsweise offen andere diskriminiert, gilt unter Demokratinnen und Demokraten als menschlich unmöglich.
Auch nach dort kann also die Freundlichkeit kippen: in die übertriebene Pseudofreundlichkeit, in das naiv-sentimentale ‹Brückenbauen›.
Bewegliches Gleichgewicht
Eigentlich ist Freundlichkeit der Inbegriff des beweglichen Gleichgewichts, eines Schwebe- und Schwellenzustands, in dem sich die Dinge im Dialog so oder so entwickeln können. Ich mag in einer Begegnung, in der ich freundlich bin, zustimmen oder widersprechen, immer kann ich dabei wahrnehmen und deuten, wie der andere reagiert, und dann darauf wieder in Resonanz gehen. Es hat etwas Spielerisches, vielleicht sogar Experimentelles. Freundlichkeit schafft Dynamik.
Sie ist entwaffnend. Sie ist der Modus der bewussten Seele, die Gestimmtheit zwischen Ich und Ich. Sie ist die moralische Tat und nicht die Beschwörung.
Natürlich hat sie Geschwister, wie den Respekt oder die Offenheit oder das Interesse. Aber trotzdem unterschreiben wir Briefe in der Regel nicht «mit interessierten Grüßen». Wir halten Abstand und zeigen so unseren Respekt, auch wenn wir in unserem Schreiben eine Beschwerde vorgebracht haben. In der Freundlichkeit ruhen die Affekte, sie bleiben gebannt. Wir erziehen uns in der Freundlichkeit selbst. Sie ist der Schulungsweg, der mitten durch den Alltag verläuft, der Schulungsweg, auf dem wir uns bereits befinden, wenn wir nur am Morgen aus der Tür gehen, wenn wir einen Bus betreten, wenn wir im Büro die Kolleginnen und Kollegen begrüßen, oder am Abend den Partner oder die Partnerin. Es kann ein entscheidender meditativer Moment allerhöchster Bewusstheit sein, wenn ich bei einer Begegnung bemerke, wie der andere gestimmt ist, was er ausstrahlt, ob er in seiner eigenen höheren Welt gerade anwesend ist oder ob ich ihm vielleicht dorthin helfen kann, in die bestmögliche Version seiner selbst. Ich ‹studiere› dann den anderen nicht wie ein Objekt, und wenn es mir doch unterläuft, dass ich mich in meiner Achtsamkeit auch ein wenig selbst bespiegele, kann ich mich dabei ertappen. Es ist das Zurückhaltende der Freundlichkeit, das Beiläufige und Unmerkliche, das sie so schön macht, so anmutig und freilassend. Sie macht kein Gewese um sich. Aber gerade dadurch öffnet sie die Tür für die feineren Wahrnehmungen. Sie ist die Kontaktschwelle, die immer spürbar bleibt: Was mir entgegenkommt, ist es Freund oder Feind? So befragt sie sich selbst. Sie studiert und beobachtet, was im eigenen Inneren geschieht, und bleibt aber im Modus des Lernens und Erforschens.
Frei von Gewalt
Nicht zuletzt hilft Freundlichkeit auch auf dem belasteten Terrain zwischen den Geschlechtern. Freundlichkeit übt keine Gewalt aus. Sie braucht keine Feindbilder und sie will nicht die anderen erziehen. In einem Gedicht über eine gescheiterte Beziehung schrieb Brecht: «Wir waren miteinander nicht befreundet / Als wir einander in den Armen lagen.»3 Der Grund für das Scheitern von Ehen liegt oft darin, dass auf der geistig-seelischen Ebene eine gemeinsame Orientierung und Verbundenheit fehlt, und dann verfehlt man einander, auch wenn man sich sinnlich liebt und begehrt. In der Freundschaft, die mit der Freundlichkeit eng verwandt ist, achtet und ‹sieht› man den anderen um seiner selbst willen, und bleibt einem Urbild treu, an das man unabhängig von den körperlichen oder sozialen Hüllen und Rollen glaubt.
Haben wir dieses Urbild in den Stürmen des Lebens aus den Augen verloren, bescheinigen wir einander bitter, auf dem falschen Dampfer zu sein, und fürchten insgeheim, dass wir selbst es sind. Die Freundlichkeit im Alltagsmeer ist aber weder ein Dampfer, auf dem die Guten unterwegs sind, die alles richtig machen, noch ist es ein Kreuzfahrtschiff zur Erholung von den Sorgen und der Unbill des Daseins. Die Freundlichkeit ist das Fischerboot, von dem aus Christus auf dem See Genezareth den Sturm stillt und die Freunde beruhigt.4
Menschenkundlich steht die Freundlichkeit am Ort des Ich. Streng genommen ist dieses ja selbst kein Wesensglied, sondern es verwandelt jene. Als Ich-Organisation orchestriert es das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen. So hat auch die Freundlichkeit keine eigene Agenda, sondern bestimmt und verbindet sich stets neu. Ja, vielleicht ist die Verbindlichkeit diejenige ‹Schwester›, neben der Offenheit und dem Respekt, mit der die Freundlichkeit am meisten vertraulich ist, der sie sich am stärksten zugehörig fühlt.
Großmut lernen
Vor einiger Zeit hatte ich zwei Erlebnisse im ICE. Dies war das erste: Ich sitze hinten in einem ausgelasteten Großraumwagen. In Frankfurt am Main steigt eine türkische Familie zu. Kaum haben sie in den zwei Viererabteilen mit Tisch unmittelbar vor meinem Sitz ihren Platz gefunden, beginnen zwei von ihnen, zwei Frauen, vielleicht Schwestern, mit jemandem Dritten zu telefonieren, offenbar gilt es, ein kompliziertes logistisches Problem zu lösen. Sie reichen sich gegenseitig immer wieder das Handy und telefonieren laut und mit Unterbrechungen eine gefühlte Dreiviertelstunde lang. Ihnen gegenüber, auf dem einzigen noch freien Platz in den von der Familie besetzten zwei Viererabteilen, sitzt ein allein reisender älterer Mann. Er hält sich lange Zeit merklich zurück damit, etwas zu sagen, bis es – offenbar aufgrund eines Blicks oder einer ‹Hast du ein Problem?›-Geste der telefonierenden Frau – plötzlich ungehalten aus ihm herausplatzt. Entsprechend gereizt reagiert nun wiederum die Frau. Der Mann beginnt daraufhin laut und grundsätzlich über die Familie und deren Verhalten zu schimpfen und es indirekt und unterschwellig als typisch für Ausländer darzustellen. Sofort stehen zwei dem Habitus und dem Äußeren nach linksbürgerlich wirkende Fahrgäste aus den umliegenden Sitzreihen auf und weisen den Mann deutlich, aber maßvoll zurecht. Sie tun dies weder spürbar aggressiv noch spürbar empathisch, sondern – gewissermaßen – wie etwas Unumgängliches, im Gestus selbstverständlicher demokratischer Pflicht. Der Mann gerät daraufhin sozial und intellektuell in die Defensive. Er verteidigt sich mit der rhetorischen Frage, warum sich die Fahrgäste nicht genauso über das Telefonieren moralisch empört hätten und warum nur er jetzt der Buhmann sei. Als er unvermittelt anfängt, ein deutsches Volkslied zu intonieren, scheint das allgemeine Urteil gefällt: ein hoffnungsloser Fall und Querulant, ein typischer weißer alter Mann. Kopfschüttelnd gehen die beiden Fahrgäste zu ihrem Sitz zurück.
Ein anderer ICE, Wochen vorher, der Ruhebereich in einem schwach besetzten Großraumwagen: Ein mit starkem Berliner Akzent unaufhörlich parlierender Vater und sein ungefähr sechzehnjähriger aufgeweckter Sohn, beide in Jogginghosen, unterhalten sich angeregt über die Bahn, offenbar ihr gemeinsames Hobby. Sie diskutieren ohne Pause intensiv über Stellwerke, Streckenstilllegungen und Fahrpläne und unterhalten damit den ganzen Wagen, in dem sonst kaum jemand redet, weil die meisten allein reisen oder müde und gedankenversunken aus dem Fenster schauen. Ab und zu jedoch schmunzelt jemand. Denn man kann jedes Wort der beiden verstehen und erfährt eine Menge über Eingleisigkeit, Personalwechselprobleme und Dieselloks. Niemand beschwert sich. Der Vater und sein Sohn wirken wie beschützt.
Warum war hier so viel Gelassenheit im Raum, warum bei dem anderen Erlebnis nicht?
Vielleicht war es jenes Unverbindliche, das im ICE mit der migrantischen Großfamilie, dem ‹weißen alten Mann› und den ‹woken› Fahrgästen die agierenden Parteien gelähmt hatte. Denn auch zwischen der telefonierenden Familie und den beiden ihr helfenden Mitreisenden war keine Verbindung spürbar gewesen, keine innere Beteiligung, kein dankbares Lächeln, keine Nachfrage, während in jenem anderen Großraumwagen Großmut im Wortsinn herrschte, Raumgeben und eine intime, freilassende Freundlichkeit spürbar gewesen waren. Alle Mitreisenden ließen sie dem Vater und dem Sohn im Stillen zuteil werden. Vielleicht, weil man in ihnen unweigerlich Menschen sah und nicht Repräsentanten gesellschaftlicher Haltungen. Ein entwaffnendes Paradoxon: Nichts an den beiden war ‹typisch› – weil sie ‹Typen› waren. Weil sie als Vater und Sohn, also als Blutsverwandte, zugleich wie Freunde miteinander umgingen.
Freundlichkeit als Forschungsinteresse
«Ach wir / Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit / Konnten selber nicht freundlich sein», schrieb Brecht in ‹An die Nachgeborenen›.5 Wo wird ein solcher Boden bereitet? Nicht im Klassenkampf. Nicht durch den bloßen Vorsatz, zu den Guten gehören zu wollen. Sondern da, wo ich mich verbinde mit der konkreten Erscheinung, vor aller Bewertung, vor allem unbedingtem Wollen, da, wo ich mich mit den inneren Bedingungen des anderen befasse: Wie bist du so geworden? Freundliches Interesse ist eigentlich immer Forschungsinteresse. Niemand beispielsweise hat dem alten Mann Interesse für seine Not, seine Abwehr und seine Schrulligkeit entgegengebracht. Das Lächeln, als er zu singen anfing, war überall ein ironisch-spöttisches. Er war genauso der Verlorene, der Fremde. Warum fragte niemand: Warum bist du so ungehalten? Hast du niemanden mehr, der dich hält? Freundliches Interesse als Forschungsinteresse würde auch fragen: Wie ist es möglich, dass man keine Wahrnehmung hat, wie aufdringlich es ist, laut und privat zwischen lauter Unbekannten zu telefonieren? Das gibt es ja mindestens so häufig bei Mitbürgern und Mitbürgerinnen zu bestaunen, die keinen Migrationshintergrund haben. Und war es nicht unendlich interessant, und kurios ohnehin, dass der Mann plötzlich in reinstem Bariton zu singen begann?
Brecht beendet sein berühmtes Gedicht an die nachfolgenden Generationen mit der Bitte um Nachsicht. Jemandem etwas nachsehen: Welch vielschichtiges Wort und welch freundliches! Der grimmige Mann im ICE hat der Familie gegenüber diese Nachsicht ebenfalls nicht aufbringen können – und hatte am Ende in einem ganz anderen Sinne das Nachsehen.
Meint dieses schillernde Tätigkeitswort, dass der Blick auch dann am anderen haften bleibt und ihn begleitet, ihn sieht und ihm verbunden bleibt, wenn jener ins Abseits oder aus dem Blickfeld geraten ist? Wie kann ich jemandem aktiv etwas ‹nach-sehen›? Sehe ich etwas nachträglich ein? Sehe ich ihm nachträglich das Gute an, das er bloß in dem Moment bei sich nicht hatte aktivieren können?
Und meint das Gleiche auch die Freundlichkeit? Dieses Gute in dem anderen grundsätzlich sehen zu wollen und anzuerkennen und zu adressieren?
Ja, selbst dann, wenn man sich vor allen für immer unmöglich gemacht hat, muss es einen geben, der bezeugt, dass man möglich gewesen war. Einen Freund, der den Sturm in der Seele besänftigt. Und der weiß, dass man trotzdem gelebt und sich bemüht hat.
Bild ‹Tugenden›, Laura Summer, 2025: Jungfrau (Schmeichelei – Unhöflichkeit, Höflichkeit > Herzenstakt)
Fußnoten
- In: Bertolt Brecht, Gesammelte Gedichte Band 3, Edition Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt 1976, S. 1022.
- ‹Die Maske des Bösen›, in: ebenda, S. 850.
- ‹Liebeslied aus einer schlechten Zeit›, in: Bertolt Brecht, Gesammelte Gedichte Band 2, S. 748.
- Mk 4, 35–41.
- In: Bertolt Brecht, Gesammelte Gedichte Band 2, S. 722.




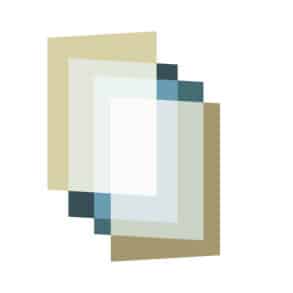





Der Beitrag von Andreas Laudert zur Freundlichkeit als absichtslose Kunst (…als soziale Kunst der Zukunft)ist ganz wunderbar in eine persönliche Zeit gefallen, wo genau diese Inspiration – dieser deutliche Auftrag – zu anderen Erfahrungen dieser Qualität passt. Er fasst vieles zusammen, was ich in den vergangenen 73 Jahren gesammelt habe an „Errungenschaften“ in diesem Leben. Letztlich ist es die Erfahrung, dass es das Zurückhaltende der Freundlichkeit ist, das Beiläufige und (fast) Unmerkliche, das sie so schön macht. Und ja, es geht – fast voraussetzunglos. Ich habe das unter dem Strich in 55 Jahren Politikerfahrung und 10 Jahren Geflüchtetenhilfe so erlebt. Und diese Tugend der Freundlichkeit läßt die mir in unseren anthrop. Zusammenängen oft unangenehme „Süßlichkeit oder Verblasenheit“ ausser acht! Ich übe daran als vordergründig eher auch einmal scharfkantiger und „wehrhafter“ Mensch.
In der aktuellen ZEIT erschien ein Artikel zu Forschungsergebnissen des Psychologen Raphael Huber von der UNI Bern, „Nicht dein Ernst“, der genau das im Kern wissenschaftl. bestätigt.
Ich danke zum Jahreswechsel dafür!
Joachim Bernecke, Braunfels
Diesen Artikel nehme ich mir erfreut zu Herzen und würde ihn gern den meisten Politikern dieser Welt zukommen lassen. Er könnte auch den parlamentarischen Betrieb sehr erleichtern.
Herzlichen Dank dafür