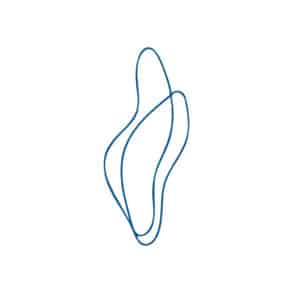‹Ich gebe mein Bestes›, schrieb ein Freund, als er entnervt mit seinen Kindern den zehnten Tag zu Hause in Quarantäne saß, ohne dass einer von ihnen krank war.

Ich fragte ihn: «Dein Bestes, warum, wofür?» Der Superlativ ist eine Konstruktion des neuzeitlichen Menschen. Es fühlt sich viel natürlicher an, zu sagen: «Ich gebe mein Gutes.» Darin liegt eine Harmonie, die integrativ ist. ‹Mein Gutes geben› geht gar nicht ohne den Zusammenhang zum Leben. Es bleibt beweglich, dieses Gute, in jedem Moment. Und es setzt nicht unter Druck, effektiv, effizient oder irgendwie sein zu müssen. Es erlaubt ein Selbstgespräch, was mir der Superlativ nicht zu tun scheint. In ihm lebt eine Entmündung, die ich zulasse, weil ich glaube, es zu müssen. Aber das Beste ist nicht mehr wert als das Gute. Eher im Gegenteil. Und schon immer hat mich unter Druck gesetzt, wenn ich sagen sollte, was mein Lieblingsbuch oder meine Lieblingsfarbe oder wer meine beste Freundin ist.
‹Ich gebe mein Gutes, Schönes und Wahres› resoniert – vielleicht gar mit etwas, was auch außerhalb meiner selbst im Kosmos, im Leben zu Hause ist. Und was uns beide bewohnt.