Einmal im Jahr, oft an einem von Religion und Tradition bestimmten Tag, gedenkt die Gemeinschaft der Lebenden der Gemeinschaft der Toten. In vielerlei Arten wird je nach Kultur ein Totengedenken gefeiert, nicht selten über mehrere Tage andauernd. In der nördlichen Hemisphäre zelebrieren wir Tage wie Totensonntag genau dann, wenn das Licht sich immer weiter zurücknimmt und die Natur leise verstummt, bis sie nur noch gedämpfte Töne von sich gibt.
Was heißt Gedenken?
Jeder Mensch gedenkt derjenigen unter den Verstorbenen, die ihm noch immer nahe sind, der Liebsten, die er im Inneren trägt, und andere, die schon in einige Ferne gerückt sind, weil ihr Sterben weiter zurückliegt, holen wir im Gedenken wieder ein. Wir er-innern sie. Manchmal haben sich die Verstorbenen so weit entfernt, dass eine ganz neue Art von Nähe entsteht. Eine Trennung, die Rainer Maria Rilke als ein ‹Übermaß von Nacht› bezeichnete:
So lass uns Abschied nehmen wie zwei Sterne
Rainer Maria Rilke, Gedichte, Paris, Frühsommer 1925
Durch jenes Übermaß von Nacht getrennt
das eine Nähe ist, die sich an Ferne
erprobt und an dem Fernsten sich erkennt.
Es werden Rituale gefeiert, altvertraute oder neu erfundene, mit anderen oder nur für sich allein. Ein Weihedienst an einem gemeinschaftlichen Ort, in einem kirchlichem Raum – oder etwas ganz Privates in der Intimität des Zuhauses. Denn ist es nicht das Kennzeichen der Lebenden, dass sie ein Zuhause haben?

Auf dem Friedhof, wo man mit vielen zusammen ist an diesem Tag, und doch allein, wird das Grab für den Winter ausgestattet. Kerzen und Blumen gehören dazu. Aber auch ein bitterer Wind, wie er nur auf einem Friedhof wehen kann. Neu aufgetauchte Bilder, Zeugen eines Dagewesenen, schmücken erneut den Grabstein oder den Gedächtnisort. Erinnerungen blühen auf. Trauer und Heiterkeit gehen Hand in Hand. Oft, wenn es schon zu dunkeln beginnt, geht jemand unter einem trägen, tief hängenden Wolkenhimmel ein Stück Weg in Richtung Horizont, wo noch ein letztes Rot aufleuchtet. Eine Sonne, die nicht untergehen will?
Alles Lebendige hat einen Anfang und geht ab diesem Moment auf sein Ende zu. Vor der Geburt fängt das Sterben an. Die Blüte trachtet nach den Samen. Werden und Ent-Werden bedingen einander, was wird, trägt bereits das Gewordene in sich. Eintritt und Austritt sind wie ein zweifacher Schwellenübertritt, wie zwei Türen und zwischen ihnen die Atmung der Wellen, Flut und Ebbe, ein kurzer Ausschnitt in der flutenden Zeit, ein Menschenleben.
Niemand weiß das so klar und genau wie die Kinder. Der vierjährige Enkel, der mich schon vor langer Zeit fragte: «Und weißt du schon, wann du sterben wirst?», um gleich weiterzuspielen. Oder der kleine Junge, der, sobald der Großvater ihm die Tür geöffnet hat, ganz heiter sagt: «Na, bist du noch nicht gestorben, Großpapa?»

Flügelpaar
Geburt und Tod, die beiden Flügel unseres Lebens, ähnlich wie die Seitenflügel einer Ikonostase, wo Gabriel und Michael dargestellt sind: sich aufhaltend über den beiden Türen als Hüter der beiden Schwellen. Jeder hütet seine Tür: Michael die Tür des Sterbens, Gabriel die Tür des geborenen Werdens, und trotzdem trägt jeder zugleich die andere Tür mit in seinem Sein. Denn wer durch die eine Tür hereinkommt, geht durch die andere wieder hinaus. Zusammen hüten sie unsere Leben. Jedes Leben, ob kurz oder lang, ist eine bewegliche, eine entstehende und vergehende Gestalt in der Zeit. Tod und Geburt sind die zwei Seiten einer Ganzheit, die wir einst von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Hier aber, zwischen Michael und Gabriel, bleibt uns das Königsportal, auf das wir von diesseits schauen dürfen, auch wenn es unzugänglich bleibt. Was sich dahinter, im Jenseits als eine Verwandlung vollzieht, entzieht sich unseren Blicken. Dahinter heißt Tod Leben und Leben Tod.
Wir nehmen Teil an der heiligen Mahlzeit. Eine Mahlzeit, an der auch diejenigen im Jenseits, die Verstorbenen, teilnehmen können und die in vielen Kulturen gerade am Totengedenktag auch ein Moment der feierlichen Rituale darstellt. Es wird mit den Verstorbenen tatsächlich eine gemeinsame Mahlzeit gefeiert. Die Grenze ist aufgehoben! Diesseits und Jenseits begegnen sich, wo Brot geteilt und der Grabstein einen Moment zum Altar erhoben wird.
T. S. Eliot lässt in seinem tief sich einprägenden Gedicht ‹Die Reise der Weisen› einen der drei Weisen sich rückerinnernd fragen, was sie da einstmals in Betlehem geschaut haben? Was ist ihnen da am Ende ihrer Reise begegnet, als sie endlich nach unzähligen Entbehrungen unter der Schneegrenze in einem grünenden Tal mit fließendem Bach angelangt waren?
Dies hier: wohin wurden wir den ganzen Weg geleitet
T. S. Eliot, Ariel Poems, 1927
Zur Geburt oder zum Tod? Da war eine Geburt, mit Sicherheit.
Wir waren Augenzeugen, zweifelsfrei. Ich hatte Geburt gesehen und Tod
und geglaubt, es gäbe einen Unterschied zwischen beiden; diese Geburt war
schwer und schmerzhaft für uns, wie der Tod, unser Tod.
Denn das Verweilende erst weiht uns ein.
Rainer Maria Rilke, Sonette an Orpheus, XXII
Beide, Geburt und Tod heißen Abschied. Wir hören nicht auf, uns zu verabschieden. Was sich unterscheidet, ist die Tür, durch die wir hindurchgehen. Manchmal, im Durchschreiten, halten wir einen Moment inne, manchmal werfen wir einen Blick auf das, was sich hinter uns bereits im Unerreichbaren verwandelt hat, manchmal haben wir uns schon lange vorher verabschiedet, noch ehe wir an die Tür gelangt waren, und gehen an ihr vorbei.
Es gibt eine antike attische Grabstele aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., die den Namen ‹Großer Abschied› trägt. Auf einem aufrecht stehenden Gedenkstein ist im Halbrelief eine Darstellung angebracht, in der eine stehende Figur sich von einer sitzenden verabschiedet. Oft gibt es nur diese zwei, oft haben sich mehrere Figuren um die Sitzenden herum versammelt. Es sind die Nächsten, die Lebenden, die sich beide mit größter Würde, Serenität und in tiefer Stille voneinander verabschieden.
Auf der Stele des großen Abschieds nimmt eine Frau Abschied von einem auf einem Stuhl wie auf einem Thron sitzenden jungen Mann, und während sie beim rechten Puls ihn fasst, wendet sie mit der linken Hand in einer unendlich sanften Gebärde sein Antlitz empor zu ihr. Ihre Blicke begegnen sich. Hinter ihm steht ein Knabe mit der Handgeste des Sich-Besinnens. ‹Dexiosis› – ‹Handreichung mit der rechten Hand› heißt diese klassische, griechische Szene, wobei die Lebende dem Verstorbenen die Hand reicht, obwohl bei dieser Stele nur die rechte Hand des Verstorbenen im Spiel ist. Dafür aber schaut die Frau ihn mit einer nie mehr endenden, gelassenen Zärtlichkeit an. Beide verweilen in dem Blick des anderen.
Sterben war damals für die griechische Seele eine Art Einweihung. In dem letzten Gespräch zwischen Sokrates und seinen Freunden, einem Gespräch, in dem sie verweilen, geht es vorbereitungsweise auf diesen Höhepunkt zu. Sokrates weiht seine Freunde in die Unsterblichkeit der Seele ein und wird dann selbst im Tod eingeweiht. Das heißt, er weiht sich selber ein. Eine selbst vollzogene Einweihung.
Dass es um eine Einweihung geht, wird schon dadurch klar, dass Sokrates seinen Mantel über das Haupt gezogen hatte, ähnlich wie der ‹Myste›, der Mysterienschüler, sich das Haupt verhüllt im Moment der Einweihung. Nur einmal schlägt Sokrates, nachdem er das Gift getrunken hat, den Mantel, der sein Haupt bedeckte (‹enkalypsamenos›), für einen kurzen Moment zurück. «Ich bin dem Asklepios noch einen Hahn schuldig, vergiss nicht, ihn zu opfern», sind seine letzten Worte an Kriton. Asklepios zu opfern, war ein wohlbekannter Brauch, wenn man von einer Krankheit geheilt worden war. (Platon, Phaidon, 118a)

Tonarten des Abschieds
Die größeren Abschiede, die das Leben zerschneiden in ein Davor und ein Danach, werden von den kleineren in ihrer Vielfalt an Tonarten begleitet. Es bleibt erstaunlich, in wie vielen alltäglichen Zusammenhängen wir Abschied nehmen. Denn wir verabschieden uns nicht nur von denen, die uns nahe sind, wir verabschieden uns auch von hoffnungsvollen Erwartungen, vom Erworbenen und von heiligen Überzeugungen, von unserem Vertrauen und fester Sicherheit.
Aber stimmt es, von kleineren und größeren Abschieden zu reden? Ist nicht jeder Abschied ‹groß›? Unzählige Menschen haben sich auch dieses Jahr verabschiedet. Gestorbene wie Lebende. Unzählige haben ihr Zuhause, das Merkmal eines Lebenden, hinter sich gelassen. Die Umstände ließen Ihnen keine andere Wahl. Einige haben die Tür hinter sich zugemacht und sich auf noch nie begangene Pfade begeben. Wo es kein Vorher, kein Nachher gab. Einige haben die Tür offen gelassen, damit es ihnen bis zum letzten Moment möglich war, noch einen letzten Blick ins Innere des Hauses werfen zu können. Andere begaben sich auf den Weg, ohne einen einzigen Blick auf die Wohnung zu werfen, weil es sie und auch die Tür nicht mehr gab. Einige haben den Schlüssel mitgenommen, in der Hoffnung, er würde andere Türen öffnen. Beide, Hoffnung und Schlüssel, sind verrostet. Einige haben zwar noch eine Tür, aber andere halten den Schlüssel. Einige haben eine Handvoll Erde mitgenommen, sie nennen es Heimaterde. Sie sind davongegangen, ohne sich umzuwenden, ohne nur noch einmal den Duft des vor kurzem gepflanzten Apfelbaums einzuatmen.
Unzählige haben ihr Leben hinter sich gelassen, ihr gelebtes und ihr ungelebtes. Das ungelebte Leben lastet am schwersten. Sie gingen schweigend, nicht einmal eine Spur hinterlassend, Bitterkeit wuchs um sie herum. Viele, wenn nicht alle, haben demjenigen, was ihnen lieb war, den Rücken zugekehrt. Was ihnen bleibt, hat sich in einem einzigen, fast gewichtslosen Bild zusammengeschrumpft: ein Haufen vertröstende Erde, ein Ufer und seine unerreichbare Nähe, die flüchtigen Schatten auf einem Gebirgsgipfel, Vögel hoch über einer Stadt vorüberziehend, Stimmen und Gerede beim Einschlafen, in einer fernen Küche der Lärm vom Geschirr.
Heimkehr zum Wesentlichen
Abschied auch als dieser unfassbar gravierende Moment der Abfahrt, wenn das Schiff sich von der Kade abdreht und die Segel, den Wind entgegennehmend, in einem Zug sich entfalten. Los, los geht das Schiff und keine Rückkehr mehr.
‹Abfahrt› (1932–1935) nannte Max Beckmann sein Triptychon, das er als erstes einer ganzen Reihe malte, als ihm im Deutschland der 30er-Jahre selbst eine ‹Abfahrt› bevorstand.
Die zwei Seitenflügel stellen Szenen einer Tortur da, wobei Figuren, in Abscheu weckender Art und Weise, gepeinigt und gemartert werden. Im Mittelteil sehen wir eine Abfahrt. Im Vordergrund ein kleines Schiff, auf dem zwei mythologisch anmutende Gestalten stehen, die den Betrachtenden den Rücken zukehren. Eine hält einen Fisch mit der Hand, eine trägt eine Königskrone, beide schauen in die Richtung, in die das Schiff sich dreht. Vor ihnen entfaltet sich bald der weite Himmel und der Meereshorizont. Sie wenden sich nicht mehr um.
Eine einzige Figur blickt zum Betrachter, die junge Frau mit dem Kind, das sie fast gewaltvoll an sich drückt. Sie hält das Kind so, dass es zum Meer schaut. Sie aber schaut zurück auf das sich entfernende Ufer. Sie schaut zu jenen, die am Ufer zurückbleiben. Sie schaut uns an.
Im dritten der vier ‹Ernsten Lieder› hat Johannes Brahms mit den Worten einer Bibelstelle dieses Sich-Umwenden in ein Lied übersetzt:
Ich wandte mich und sahe an, alle,
Prediger Salomo 4,1–3
die Unrecht leiden unter der Sonne;
Und siehe, da waren Tränen derer,
Die Unrecht litten und hatten keinen Tröster;
Und die ihnen Unrecht täten, waren zu mächtig,
Dass sie keinen Tröster haben konnten.
Die Frau schaut auf die in ihrem Blick sich langsam auflösenden Gestalten und sieht erst jetzt, was bis zum Moment der Abfahrt immer verhüllt geblieben war. Im Abschied wird die Wesenspotenz des Gestalteten wieder frei. Das Potenzial sowohl des Abfahrenden als auch des Zurückbleibenden und das, was sie verbindet. Jetzt weiß sie, was lieben heißt und was Trost. Im Kind, das sie dem Horizont zuträgt, erneuert sich die Potenz des Wesentlichen. Sie wird zu einer Verkündigung der Liebe.
«Abfahrt, ja Abfahrt vom trügerischen Schein des Lebens zu den wesentlichen Dingen an sich, die hinter den Erscheinungen stehen. Dies bezieht sich aber letzten Endes auf alle meine Bilder. Festzuhalten ist nur, dass ‹die Abfahrt› kein Tendenzstück ist und sich wohl auf alle Zeiten anwenden lässt.» So hält es Beckmann in seiner Korrespondenz mit dem Kunsthändler Curt Valentin in seinem Brief vom 11. Februar 1938 fest.
Dazu sagte Beckmann gegenüber Lilly von Schnitzler, wie die Fahrt, die zu den «wesentlichen Dingen an sich» geht, mit dem Gewinn an Freiheit verbunden ist und zugleich eine Heimkehr darstellt.

Andenken und Gedenken
An was wird ‹gedacht› am Totengedenktag? Denken die Lebenden an die Verstorbenen? Wäre es denkbar, das nur einmal umzukehren und sich umzuwenden? Wieso ‹gedenken› wir? Weist ‹Gedenken› nicht einen Bezug auf zu demjenigen, was einst gewesen ist und jetzt nicht mehr da ist? Daher die vielen Andenken, wie geronnene Zeichen des Einstigen, die dieses Gedenken lenken und stützen? Als seien sie, die Verstorbenen, nicht immer da!
Ganz im Sinne Rudolf Steiners schreibt Arie Boogert wie wir «als Lebende für die Verstorbenen immer gegenwärtig sind. Und wir trotzdem im Alltagsleben an ihnen vorbeigehen, weil wir vergessen, dass ihre Welt die unsere umfasst und unsere Welt ganz und gar ein Teil der ihrigen ist.»1
Wie wäre es, wenn es um eine einzige verflochtene Gemeinschaft ginge, wobei Verstorbene und Lebende einander gedenken? Eine Gemeinschaft des ‹Menschlichen› schlechthin im Diesseits und im Jenseits? Diejenigen ‹dort drüben›, die schauen, was unsere Augen im Diesseits nicht sehen, würden uns dafür ‹ihre Augen› leihen? Während wir, die hier sind, dasjenige erleben, was ihnen im Jenseits nicht länger zugänglich ist, und ihnen unser Erleben zukommen lassen?
Wie gedenkt man dieser Verflechtung? Einer Verflechtung, die daraus besteht, dass auf beiden Seiten das anwesend wird, was in seiner Verschiedenartigkeit immer neu entsteht und erschaffen wird. Wie feiert man die Gegenwärtigkeit des anderen Menschen? Sein Gegenwärtig-Werden, wie es uns sich sanftmütig und leise annähert. Damit wir uns umwenden? Es gibt nur eine Antwort: dadurch, dass ich selber immer mehr anwesend werde. Wach und heiter. Entgegen jeder Form des Schwermuts. Anwesend werden, gegenwärtig werden heißt deswegen: ‹zelebrieren›. Erwachen ist Freude. Genau das wurde in einer Einweihung vollzogen. Im heutigen Dialog zwischen Verstorbenen und Lebenden geht es um Einweihung in Geistesgegenwart. Das Gemeinsame, der Geist und sein Gegenwärtig-Werden, wird jedes Mal erprobt, ähnlich wie eine Ferne, die eine Nähe werden kann. Eine Annäherung von Geburt und Tod, wie es in einer Einweihung erlebbar wird. Sind es nicht Geburt und Tod, die sich im Gedenken gegenseitig erkennen?
Hängt es mit dem zusammen, was wir Dankbarkeit nennen? Fast selbstverständlich pflegen wir Dankbarkeit den Verstorbenen gegenüber. Aber dankbar wofür? Danken und Gedenken haben einen Bezug zueinander, den Heidegger ausgeführt hat. Die vielen Gründe aber, aus denen man den Verstorbenen danken kann, lassen sich in einem einzigen zusammenfassen: Wir danken den Verstorbenen für ihr Gegenwärtig-Werden, für ihre An-Wesenheit in uns. Und wir können ihnen nur dadurch danken, dass wir selber an-wesend werden.
Bilder Miriam Wahl, ‹Was Goldmarie sich hinter die Ohren schrieb›, Gouache und Acryl auf Papier, 2023






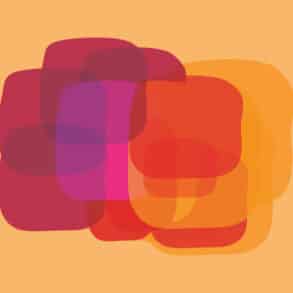



Sehr schön! Brava!
«Sterben war damals für die griechische Seele eine Art Einweihung.»
In der Ilias werden Sterben und Tod kultisch gefeiert, auch um auf das Sterben und den Tod von Ihm vorzubereiten (Ilias 16:666). Das sind sehr schwierige Momente mit Echos und Spiegelungen bis in die Odyssee.
Deshalb kommt R. Steiner in seinem letzten Vortrag auf der Weihnachtstagung unmittelbar nach dem «Raout» vom 1.1.24 auch auf die Themen der Vorträge vom 24. und 25.12.23 zurück.
R. Steiner sagt dort:
«Kam man mit diesen Ideen, die götterwürdig und götterwert ausgebildet waren, vor den Huter der Schwelle, dann sagte einem der Hüter der Schwelle: Du kannst passieren, denn du bringst hinüber in die übersinnliche Welt dasjenige, was schon während deines Erdenlebens im physischen Leibe nach der übersinnlichen Welt gerichtet ist.» (GA 233 Seite 153)
Das bedeutet, in unsere Sprache übersetzt, alle Homeriden können den Hüter der Schwelle anstandslos passieren. Es ist kein Ausweis nötig, nichts, es gibt keine Diskussion, man wird durchgewunken, fertig.
—
«Sokrates weiht seine Freunde in die Unsterblichkeit der Seele ein und wird dann selbst im Tod eingeweiht. Das heißt, er weiht sich selber ein. Eine selbst vollzogene Einweihung.»
Aber Sokrates wird dazu gezwungen. Es handelt sich um Mord! Es sind Mörder, Verächter von Religion und Philosophie, die sich zu Wächtern der Religion und Philosophie aufgespielt haben. Es ist Unrecht! Jedes Kind weiss das.
Natürlich möchte man gerne einen Sinn dahinter erblicken. Kann man ja auch. Ohne die Ermordung des Sokrates hätte es die Texte von Platon und Xenophon in dieser Form nicht gegeben. Auch der Auftritt von Aristophanes im ‹Symposion› des Platon ist natürlich eine Reaktion auf die abscheuliche Rufmordkampagne gegen Sokrates, die Aristophanes mit ‹Die Wolken› losgetreten hat.
Im 23. Sonett an Orpheus ist die Antwort auf den 22. enthalten, ist mir jetzt erst aufgefallen, völlig abgefahren! Thx! Wusste ich gar nicht, dass das iwie zusammenhängt. So gut der Shit, unfassbar!