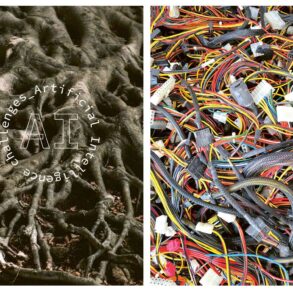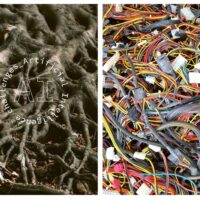Literarische Betrachtung über den geheimnisvollen Augenblick, in dem das Leben selbst ins Bewusstsein kommt und Sprache zu schreiben beginnt.
Ich bin kürzlich auf das Gespräch ‹Das Leben selbst will ins Bewusstsein kommen›1 gestoßen, was mich nachhaltig beeindruckt hat. In einer lemniskatenförmigen Bewegung wird ein Todespunkt beschrieben, der einen Nullpunkt hat, der eine Öffnung ist. In dieser Bewegung erkenne ich etwas, das in meiner literarischen Arbeit den seltenen und entscheidenden Moment anzeigt, in dem mir etwas Neues geschieht – das Ereignis beim literarischen Schreibakt, den Zipfel von etwas Unbekanntem fassen zu können – und sich Sätze, Sprachenergien kristallisieren, die mich dann häufig viele Jahre zu etwas durchtragen. Was dann ein neues Buch, ein neues, poetisches Grundprinzip sein könnte. Roland Barthes nennt das in seinem Buch ‹Die Vorbereitung des Romans›: «der Moment, in dem die Form abbindet». Also der Umschlag-Moment, in dem das Begehren zu schreiben in Schreiben umschlägt und sich etwas, das sich schlimmstenfalls als Writer’s Block geäußert hat, löst und ein Schreibfluss entsteht, der häufig mit einem Jubelgefühl einhergeht, das merkwürdigerweise aus dem Gefühl entsteht, ‹den Tod überlebt zu haben›. ‹Das Leben selbst will ins Bewusstsein kommen› halte ich für eine genaue Beschreibung für einen solchen Moment, aber auch die Umkehrung stimmt: Das Bewusstsein spürt, dass es ins Leben kommt.
Dichterischer Umdreh-Akt
Ein berühmtes Beispiel des Ergebnisses eines solchen Umschlags ist Prousts Madeleine-Moment, nachdem sein Erzähler das jakobsmuschelförmige Gebäck in den Lindenblütentee seiner Tante Leonie getunkt und in den Mund genommen hat und sich mit dem Geschmacksblütenknospenerlebnis satzkaskadenförmig eine ganze Kindheitslandschaft in seinem Erinnerungsraum herstellt. Eine plötzliche, epiphanische Innewerdung und Erhellung der Kindheitswelt als Ätherleib? Jedenfalls eine Erfahrung, mit der Proust einen Gründungsakt der modernen Literatur begangen und sich selbst begonnen hat, das Schreiben-Können, also das Umwandeln von Lebensstoff in literarischen Stoff, das Umwandeln von vergessener Zeit in erinnerte Zeit (aber nicht als seine rein subjektive Erinnerung, sondern erinnerte Zeit, die etwas freilegt am Prozess des intersubjektiven Erinnerungsvorgangs an sich) – zu glauben (was das Ziel seiner ‹Recherche› war). Oder mit einem harten Sprung zu Arthur Rimbauds Seherbrief (an George Izambard, 13. Mai 1871) und einem zweiten zentralen Gründungsakt der literarischen Moderne: «Im Augenblick erniedrige ich mich, so tief ich kann. Warum? Ich will ein Poet sein, und ich arbeite an mir, um aus mir einen Seher zu machen: Sie werden das natürlich nicht begreifen, und wie sollte ich es Ihnen auch erklären. Es geht darum, durch ein Entgrenzen aller Sinne am Ende im Unbekannten anzukommen. Die Leiden sind gewaltig, aber man muß stark sein, als Poet geboren, und ich habe mich als Poet erkannt. Das ist durchaus nicht meine Schuld. Es ist falsch, wenn einer sagt: Ich denke. Man sollte sagen: Es denkt mich. […] Ich ist ein anderer.» Diese Reflexion ist vielleicht der dichterische Umdreh-Akt durch einen Todespunkt, der auch ein Nullpunkt ist, par excellence. Das sind Momente, in denen die Sprache selbst einen ergreift und zu einer Selbstreflexion treibt, in der man sowohl der Spiegel als auch das Gespiegelte ist: Ein Gespenst schaut im Spiegel des Textes zurück: ein Sprung oder ein Bruch im schreibenden Subjekt, streng genommen ein Moment, in dem der Schreibende kurzzeitig verrückt wird und sich in zwei Personen zerteilt. Und dieser Moment des Verrücktwerdens ist ein kleiner Todesmoment, ‹une petite morte›, mit sich selbst am Schreibtisch.
Der Tod ist die Mitte
Vielleicht ist der Todesmoment dann die Mitte oder der Ankerpunkt, der Fixpunkt zwischen den beiden zerteilten Ich-Anteilen, und die Wahrnehmung beschreibt eine Lemniskate darum herum, was ja auch eine Beschreibung ist, für die Schicksalsbewegung in Rudolf Steiners ‹Heilpädagogischem Kurs› (so beschreibt es Wolf-Ulrich Klünker, im Vortrag ‹Anthroposophie und Psychologie im 21. Jahrhundert›). Nun erlebe ich die Momente, in denen dieser Tod eintritt, als Verwandlungsmomente: Die Luft bekommt eine andere Konsistenz, die Blätter der Linde vor dem Fenster zum Schreibtisch scheinen plötzlich ins Zimmer hineinzuschauen, das Rauschen der Straße wird zu einem Meeresrauschen, die Momente kräuseln sich und die Sekunden bekommen eine Schaumkrone. Die Metapher ‹Meer für Zeit› stellt sich bei mir wie von selbst ein, ich habe das Gefühl: Die Zeit wird ein Meer. Könnte das vielleicht ein poetischer Ausdruck für den Moment sein, in dem man sich des Ätherleibs, in dem man schwimmt und der man zugleich ist, innewird? Der Ausdruck: ‹Die Zeit steht still› ist für diese Inne-Werdung auf mehrere Arten zutreffend: Einerseits ist es ein Moment von äußerster Verdichtung, jedoch tritt vielleicht auch ein Bild aus der Erinnerung in ungekannter Frische in den Raum und zugleich weiß ich, dass solche Momente unvergänglich sind. Es sind Ankerpunkte in meinem Leben als Schriftsteller, mit denen ich mir meinen Raum baue und an denen ich merkwürdigerweise ablesen kann, dass ich mit Zeitströmungen verbunden bin, die meine Lebensdauer überschreiten: Diese Momente gerinnen zu kleinen Gedächtnissen, die auch Wegmarken sind. Pontons im strömenden Meer der Zeit. Also auch kleine Stücke Land, die ich dem Meer abgewinne. «Es nehmet aber und es giebt Gedächtniß die See», schreibt Hölderlin, in seinem Gedicht ‹Andenken› und darin klingt die französische Identität von Meer und Mutter an, die ein Homofon sind und sich nur als geschriebene Wörter unterscheiden: la mère (die Mutter) und la mer (das Meer).
Chora
Der französische Philosoph Jacques Derrida hat ein Wort entdeckt, das dem Begriff Ätherleib nahekommt und das er in Platons ‹Timaios› aufgestöbert hat: Chora. Ein Begriff für einen weder sinnlichen noch intelligiblen Wahrnehmungszustand, den Platon umschreibt mit: «die Amme allen Werdens». Chora ist ein Behältnis für alle Geschichten und Mythen, die je erzählt wurden, tritt aber selbst als Behältnis nicht in Erscheinung. Die Chora ist also etwas Unverfügbares, ähnlich wie die unwillentliche Erinnerung bei Proust, die nicht gerufen werden kann, nicht aktiv gemacht werden kann, sondern – wie bei einem kleinen Tod – nur erlitten werden kann. Sie scheint zu einem dritten Geschlecht zu gehören: weder männlich noch weiblich, weder da noch nicht da, weder dem Logos zugehörig noch der Sinnlosigkeit: etwas, das wir uns nicht vorstellen können und das als dieses Unvorstellbare den Humus bietet für unser Denken und Wahrnehmen. Hier traue ich mich nicht mehr zu schreiben: ‹Die Chora ist ein großer Ätherleib›, da ich dieser unbegreiflichen ‹Amme allen Werdens› mit Begriffen lieber nicht auf den Leib rücken möchte.
In ihrem Buch ‹Und ich schüttelte einen Liebling›, einem Requiem für ihren kurz zuvor verstorbenen Mann Ernst Jandl, schreibt Friederike Mayröcker (S. 32): «Das ist ein Seitenaltar, sage ich zu ej, was ich sagen hörte, und die Staffelei geht los und nachgezeichnet das Auge Gottes, und man müsse in Bewegung bleiben und ich schlage im ‹Groszen Brockhaus› das Wort Äther nach und finde Himmelsluft, wolkenlose Weihe, das nicht näher bestimmbare Medium, in dem sich die elektrischen Wellen im Weltall ausbreiten, Weltseele, Astralleib. Bin mit dir wie mit Ätherwellen verbunden, sage ich zu ej.»
Foto Amy Harrison, Unsplash