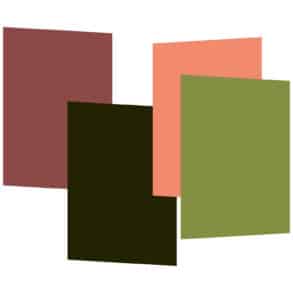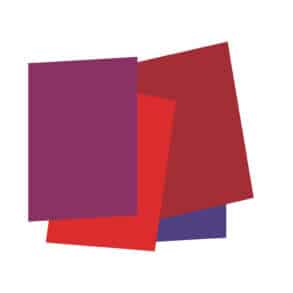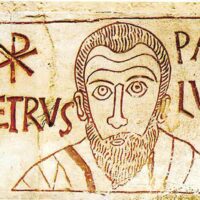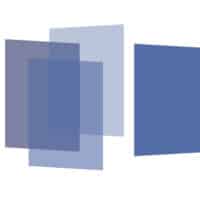Seit Anfang dieses Jahres gibt es ein Online-Austausch-Format zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Ziel ist die Erforschung und Aufarbeitung dessen, was Menschen im deutschsprachigen Raum in dieser Zeit erlebt haben und was diese Erfahrung in ihnen ausgelöst hat – individuell und kollektiv. Ein Erfahrungsbericht.
Eingeladen zu diesem Forschungslabor waren Menschen, die den Wunsch oder die Notwendigkeit gespürt haben, mit anderen auf diese Zeit zu schauen – ohne Schuldzuweisung, reflektierend und wahrnehmend, was jetzt gerade ist. Es geht darum, Unverdautes, Ungehörtes und Ungesagtes sicht-, hör- und fühlbar zu machen. Es geht darum, hinter die Fassaden vermeintlich starrer Positionen zu schauen und den Menschen mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen, Verletzungen und Ängsten dahinter zu sehen. Die Verbindlichkeit dafür sind Verschwiegenheit, Respekt, Wertschätzung und die Teilnahme an möglichst allen Terminen.
Ich bin Teilnehmerin dieses Labors, weil ich nach einem solchen Raum gesucht habe. Das gesellschaftliche Verstummen, das nach dem Ende der offiziellen Maßnahmen eingesetzt hat, das kollektive Wegschauen vor dem, was in dieser Zeit geschehen ist, hat Ohnmachtsgefühle in mir ausgelöst. Wer sorgt dafür, dass so etwas nicht wieder geschieht? Mein eigener Schmerz über das Geschehene möchte gesehen werden und auch die Angst, dass es sich wiederholen könnte, wenn wir nicht darüber reden. Die Veranstaltenden haben ausdrücklich darum gebeten, sich aus allen ‹Lagern› für eine Teilnahme zu bewerben – um ein weites Spektrum dessen abzubilden, was gesellschaftlich da ist. Um einen Raum des Sich-Hörens und -Wiederannäherns, des Sich-Gegenseitig-Verbindens und -Wiederanbindens zu ermöglichen, des Sehens und Gesehen-Werdens nach einer Zeit der Ungewissheit, Angst und Isolation. Ein Raum für Gefühle, Bedürfnisse und gemeinsames Wachsen. Dementsprechend bunt und vielfältig ist die Gruppe geworden, die sich in diesem Sommer bereits sechsmal getroffen hat. Es werden noch vier weitere Sitzungen folgen. Dieser Raum hilft uns, überhaupt eine Sprache für das Erlebte zu finden, und das Vertrauen, sich damit zu zeigen.
Ein Ort jenseits von richtig oder falsch
Ich bin, wie viele andere auch, noch einmal bzw. wieder tief eingetaucht in die Corona-Zeit. Und auch wenn wir alle den gleichen Prozess durchlaufen, ist mir bewusst, dass wir alle etwas ganz anderes erleben – genauso wie bei Corona selbst. Ich erlebe hier eine langsame, zögerliche, zarte Öffnung über einen längeren Zeitraum, ein Auftauchen, Auftauen, Aufbrechen. Gesamtgesellschaftlich ist dieser Raum eher taub, wendet sich nur sehr langsam und verhalten – und nach wie vor vor allem in den gewohnten Formaten des politisch-wissenschaftlichen Diskurses – diesem Thema wieder zu. Im Corona-Labor geht es um Begegnungen an einem Ort, der jenseits von richtig und falsch liegt.1
Wir hören mit dem Herzen zu und sprechen aus dem Herzen. Es zählt die subjektive Wahrnehmung eines und einer jeden Einzelnen. So erfahren wir eine Wahrheit, die sich mir als kollektive Weisheit offenbart und die größer ist als wir selbst. Es ist eine erlebte, gefühlte Realität, die uns Auskunft darüber gibt, wie es in unserer Gesellschaft gerade wirklich aussieht, was der Boden ist, auf dem wir aktuell stehen. Es ist in meiner Wahrnehmung ein sehr wackeliger, tief erschütterter, hoch sensibler und empfindsamer Boden, der nach einem Gleichgewicht sucht und damit fast aussichtslos ringt – wie ein Segelboot auf offenem Meer bei hohem Wellengang. Ein Boden, der auch schon vorher brüchig und fragmentiert war. Wir wollen uns dem stellen, verstehen, was geschehen ist und unseren ganz eigenen Platz darin finden. Aus systemischer und psychotherapeutischer Sicht ist das Anerkennen, was ist, immer der erste Schritt zu Heilung. Was ist, muss sein dürfen. Sonst bleibt es.
Traumaintegration
Gehalten und thematisch gestaltet wird das Labor von zwei Moderatoren, die Erfahrung mit traumainformierten2 sozialen Prozessen haben. Sie sind ausgebildet zum Collective Trauma Integration Facilitator3 bei Thomas Hübl und begleiten den Gruppenprozess im Ganzen sowie jeden Einzelnen, der in der großen Gruppe spricht. Sie sorgen für Kohärenz und den roten Faden, der uns durch die sechs Schritte des kollektiven Traumaintegrationsprozesses führt, an dem sich unser Prozess orientiert.4
Wir haben begonnen, uns mit uns selbst und den anderen im Raum zu verbinden, einen Gruppenkörper zu bilden und uns unserer Ressourcen und Qualitäten, die wir brauchen und mitbringen, bewusst zu werden. Dann haben wir uns das Feld angeschaut, das wir erforschen und bearbeiten wollen. Was ist damals geschehen? Was waren die bedeutsamsten, einschneidendsten Ereignisse? Anhand einer vorgelesenen Chronik ließen wir diese Zeit innerlich Revue passieren und spürten noch einmal genau hin: Welche politischen Entscheidungen, Diskussionen oder anderen Ereignisse haben mich am meisten betroffen? Wo ist der Schmerz, der gesehen werden möchte? Als Drittes haben wir uns intensiv mit dem Thema ‹Spaltung› beschäftigt und erforschen, wie Polarisierung entsteht und wie jede und jeder von uns dies erlebt und vielleicht dazu beigetragen hat. Was hat dazu geführt? Aus welchem inneren Ort heraus habe ich gehandelt? Wir schauen auch auf unsere Familiensysteme und was in diesen nahen Beziehungen geschehen ist. Wo gab es Brüche, wo Zusammenhalt und Unterstützung? Meine anfängliche Wahrnehmung bestätigte sich hier für mich – Corona hat nur sichtbar gemacht, was vorher schon da war: Bereits schwierige Beziehungen sind noch schwieriger geworden oder auseinandergefallen, stabile Systeme haben sich gegenseitig unterstützt oder sich vom Thema nicht beeindrucken lassen.
Diese konkreten Perspektiven ermöglichen uns, immer weiter ‹hinabzusteigen› hin zum Wesentlichen – zur eigenen Wunde und zum kollektiven Schmerz. Die verschiedenen Schritte des Prozesses überlappen sich, alle Themen finden immer wieder Raum. Dadurch entsteht kein linearer, sondern ein kreisförmiger Prozess. Derzeit sind wir an einem Punkt, an dem viel Ohnmacht gespürt wird, Wut, die keinen Adressaten findet. Es gibt den Wunsch nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, genauso wie Gefühle von Scham und Schuld, Trauer und Ratlosigkeit. Alles ist gepaart mit viel Mitgefühl, Erleichterung und tiefer Dankbarkeit für diesen Raum, wo all dies sein kann und sich zeigen darf. Alles steht nebeneinander, ist miteinander, ist nicht mehr ‹Entweder oder›, sondern ‹Sowohl als auch›: ich kann dich sehen, fühlen und verstehen und gleichzeitig bin ich nicht einverstanden, mit dem, was du getan hast. Ein Dilemma, eine Herausforderung, der wir uns in den nächsten Monaten noch stellen werden. Und sie führt uns immer wieder zu unseren eigenen individuellen und kollektiven Traumawurzeln.
Struktur und Halt
Während die verschiedenen Themen die Teilnehmenden inhaltlich unterstützen, immer tiefer an ihre eigene Wahrheit zu kommen und sie zu fühlen, schaffen die Methoden, die Arbeitsweise und der immer ähnliche Ablauf der Treffen in mir Vertrauen. Sie geben mir Sicherheit, mich ganz auf den Prozess einzulassen. Nach einer gemeinsamen Meditation gibt es einen Kleingruppenraum, in den wir uns zum Thema des Tages mit ein bis zwei anderen Teilnehmenden austauschen, uns zuhören und gelegentlich spiegeln. Diese kleinen Räume ermöglichen ein tiefes Eintauchen. Es geht ums Zuhören, Wahrnehmen und manchmal auch Aushalten. Es ist letztendlich ein Prozess der Selbstverantwortung: Ich nehme meine Gefühle zu mir, denn ich weiß, dass das, was jemand anderes sagt oder tut, lediglich Auslöser, aber niemals Ursache für meine Gefühle ist. Gleichzeitig bekommen meine Emotionen Raum. Nach diesem Austausch haben wir die Möglichkeit, uns in der großen Runde auszudrücken. Auch hier ist die Atmosphäre von wertschätzendem, wohlwollendem Zuhören geprägt. Viele von uns brauchen Mut, um sich vor allen zu zeigen, und wir erfahren hier auch aktive Unterstützung von den Moderatoren, die durch ihre Präsenz und sensible Begleitung diesen Raum halten und durchlässig machen für alles, was sich zeigen will. Oft kommen hierbei die Sprechenden an Punkte, die sie vorher nicht sehen oder fühlen konnten, und ihre Berührung und Öffnung berührt die ganze Gruppe.
Diese Art zu ‹tagen›, hat ihren Ursprung im Council, einem (Weisheits-)Rat oder Redekreis, der in verschiedenen indigenen Völkern, zum Beispiel bei den Ureinwohnern Nordamerikas oder Australiens die übliche Form zum Besprechen von Problemen, Konflikten oder zum Austausch über Freuden und Nöte des Alltags war und ist. Hierbei sitzen die Beteiligten in der Regel um ein Feuer und es wird ein Redestab herumgereicht. Nur der oder die darf sprechen, die gerade den Redestab hat. Alle anderen hören der Wahrheit des Sprechenden aufmerksam zu, bis der Redestab weitergereicht wird. Es wird so lange gesprochen, bis alles gesagt worden ist, was in diesem Moment relevant für das Thema beziehungsweise für die Lösung eines Konfliktes ist. Die Form und Dauer der Kreise variieren, Ziel dieses ‹Zu-Rate-Sitzens› ist es, Verbundenheit und Harmonie zu schaffen, Verständnis und Kooperation zu fördern, gewaltfrei Konflikte zu lösen und Gemeinschaften zu stabilisieren. Ein uraltes Werkzeug, effektiv und befriedend. Oft lösen sich Probleme während des Sprechens und Lauschens einfach auf. Oder Lösungen entwickeln sich während dieses Prozesses von ganz allein aus der kollektiven Intelligenz heraus.
Dieser Ansatz ist mir auch aus der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) vertraut. «Erst die Verbindung, dann die Lösung», heißt es hier. Und auch in der Mediation geht es grundlegend darum: Erst wenn zwei oder mehrere sich wirklich hören können, sind nachhaltige Lösungen möglich.
Corona-Listening
Diese Form des Kontaktes – ich drücke mich authentisch aus und werde wohlwollend bezeugt – hat eine beruhigende Wirkung auf unser Nervensystem. In der Traumatherapie spricht man von Co-Regulation. Ich erfahre, dass ich okay bin mit meinen Gefühlen und allem, was mich gerade beschäftigt. Das entspannt mein Nervensystem und hat wiederum eine beruhigende Wirkung auf den Zuhörenden. Wir erleben uns, so wie wir wirklich sind. Im Grunde sind unsere Nervensysteme ein großes Netzwerk – wir können uns gegenseitig entspannen oder aufputschen, triggern oder beruhigen. Indem ich mich entscheide, mein Gegenüber wirklich wahrzunehmen und zu fühlen, entspannt sich auch mein System. Ich bin nicht mehr gefangen in alten Reaktionsmustern. Angenommen sein, verstanden und wirklich gesehen werden sind universelle Bedürfnisse. Im Labor sprechen wir deshalb aus, was bislang nicht gesagt oder gefühlt werden durfte oder sich noch nicht vollständig ausdrücken konnte. Wir kreieren Raum für Reflektion, Integration und Verbindung. Jeder und jede Einzelne wirkt direkt auf das ganze System und umgekehrt.
Interessanterweise begannen ein paar Monate nach dem Start unseres kleinen Prozesses auch Corona-Aufarbeitungsbewegungen im großen Außen. Das mag ein Zufall sein und hat mich doch an Margaret Mead erinnert, die große Kulturanthropologin, die einst sagte: «Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe besonnener und engagierter Bürger die Welt verändern kann. Tatsächlich sind sie die Einzigen, die das jemals taten.»5 Das macht mir Mut. Gleichwohl ist dies erst der Beginn eines ‹Auftau-Prozesses›, der noch viel Engagement und Achtsamkeit braucht.
Die Gesellschaft hat sich während Corona extrem polarisiert, aber es geht um alte Ängste, die durch Corona (wieder) sichtbar geworden sind. Ganz persönliche sowie kollektive Ängste, die sich in all ihrer Bandbreite auch im Labor widerspiegeln: Die Angst vor Krankheit und Tod, vor Zwangsimpfung und Verlust der körperlichen Integrität, vor Verrat, Gewalt und Diskriminierung, vor Spaltung von Familien und Gesellschaft, vor dem Verlust der Grundrechte oder davor, seine Arbeit oder sein Business aufgeben zu müssen. Bei jeder und jedem Einzelnen – so meine Beobachtung über die letzten Jahre – hat es sich anders gezeigt: das Verborgene, das Unbewusste, die größte Angst.
Es ist deshalb wesentlich zu schauen, auf welchen Boden Corona – individuell und gesellschaftlich – gefallen ist. Schattenarbeit erlebe ich als grundlegend für nachhaltige Veränderungsprozesse; ein lohnender, wenn auch oft schmerzhafter Prozess.
Ich persönlich sehe mich nach nun sieben Monaten und anfänglicher Erleichterung, das Thema nicht mehr ‹allein› tragen zu müssen (ein Traumamuster), damit konfrontiert, dass ich auf meine eigene, eher stille Art, auch polarisiert habe. Ich begreife, wie sehr meine eigene persönliche Wunde mein Verhalten während Corona mit geprägt hat. Der Schmerz, der nicht weggeht. Spaltung kommt immer aus Angst, aus einer ungeheilten Verletzung, egal wie lang sie schon zurückliegt. Wie tief sich die Angst in der Corona-Zeit verfestigt hat, zeigt sich meines Erachtens auch daran, wie wichtig den Teilnehmenden ihre Anonymität und Verschwiegenheit ist. Die Vorstellung, rückverfolgt werden zu können und dadurch vielleicht weitere Nachteile oder Ausgrenzung zu erfahren, scheint sehr real und bedrohlich – und ist für mich absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig sehe ich darin auch ein Traumamuster. Uns verletzlich zu zeigen und darauf zu vertrauen, dass wir getragen und akzeptiert sind, ist für die meisten von uns nur selten erlebte Realität. Um in dieses Vertrauen zu kommen, brauchen wir als Erwachsene viel neue Erfahrung. Da dieses Projekt als geschützter Ort angelegt und vereinbart worden ist, möchte ich die Anonymität aller Teilnehmenden bestmöglich wahren und schreibe hier allein aus meiner Perspektive. Ich danke den Verantwortlichen des Labors für ihr Okay, diesen Artikel zu schreiben.
Ich habe mich dafür entschieden, weil ich denke, dass wir eine wichtige Arbeit machen, die sichtbar werden darf. Denn die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich.6
Ich lade Sie ans Feuer ein.
Das Forschungslabor zur Aufarbeitung der Corona-Zeit ist ein geschlossener Raum mit 45 Teilnehmenden, die sich für ein Jahr verpflichtet haben, einmal im Monat zu einem 2,5-stündigen Onlinetreffen zusammenzukommen. Sie durchlaufen gemeinsam einen sechsstufigen Trauma-Integrationsprozess zum Thema ‹Corona›. Organisiert wird das Projekt von der international agierenden, gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation Pocket Project. Sie setzt sich dafür ein, dass individuelle und kollektive Traumata und deren global-gesellschaftliche Auswirkungen sichtbarer werden und Aufarbeitung erfahren.
Neben den offiziellen Terminen ist es erwünscht, sich in Triaden – zu Beginn des Prozesses per Zufall festgelegte Dreiergruppen – zu treffen, um in den Zwischenräumen in Verbindung zu bleiben und den Austausch zu vertiefen.
Foto Raimond Spekking, Wikimedia Commons
Fußnoten
- Nach Rumi (persischer Gelehrter und Sufi-Mystiker, 13. Jh.: «Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.»
- Traumainformiert oder auch traumasensibel zu arbeiten, bedeutet, ein fundiertes Wissen über Trauma und seine Wirkmechanismen zu haben, diese in Prozessen zu erkennen und einfühlsam zu begleiten.
- Deutsch: Moderator für kollektive Traumaintegrationsprozesse.
- Collective Trauma Integration Process nach Thomas Hübl: 1. Sich verbinden und Ressourcen für den Prozess schaffen, 2. Das Terrain erkunden, 3. Ein Gefäß/Kanal werden, 4. Ins Feld lauschen, individuelle und kollektive Stimmen hören, 5. Integrieren und wiederherstellen, 6. Bezeugen und reflektieren des Prozesses.
- Margaret Mead, Zitate
- Charles Eisenstein, Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Scorpio Verlag, München 2017.