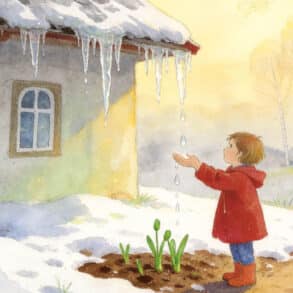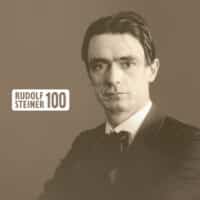Das Schicksal bildet sich aus den inneren Intentionen und den äußeren Lebensbedingungen. Mit diesem Gedanken eröffnet Justus Wittich seinen Vortrag über die gesellschaftlichen Krisen der anthroposophischen Bewegung in den 1920er-Jahren und über den Brand des Ersten Goetheanum. Dabei skizzierte er drei Schritte, die die Anthroposophie durchgemacht hat. Von 1902 bis 1909 ging es im Mantel der Theosophie um die gedankliche Individualisierung der indisch-östlichen Wurzeln zur Anthroposophie. Mit Berlin als Zentrum geschah diese Entwicklung im Stillen. In den folgenden Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt nach München mit gemeinschaftlichem künstlerischem Ausdruck. Wittich: «Was Anthroposophie geistig inhaltlich bringt, führt ein Kunstimpuls ins sinnliche Erleben.» Mit dem Kriegsausbruch staute sich das esoterische Leben und entlud sich in den Jahren nach dem Krieg in die Praxisfelder mit reger öffentlicher Tätigkeit. Rudolf Steiner spricht in der Betriebshalle von Daimler-Benz zu Tausenden von Mitarbeitenden. Er wendet sich mit sozialen Ideen an die Öffentlichkeit. Wittich: «Ein Leben von Rudolf Steiner, das völlig neue Bevölkerungsschichten einbezog, das die guten Anthroposophen fast nicht mitmachen konnten.» Zum Verständnis des Brandes des Goetheanum nahm Wittich dann drei Zeiten in den Blick: die atmosphärische Situation vor dem Brand, den eigentlichen Brand und die dem Brand nachfolgende Krise.
Aus Goetheanum TV Reihe ‹Das Leben Rudolf Steiners – Signaturen eines Werdens›. Justus Wittich: ‹Die Gesellschaftskrise und der Goetheanum-Brand›.
Bild Screenshot