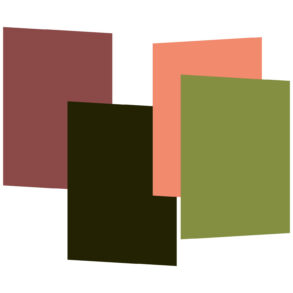Innere Entwicklung als Antwort auf die KI-Transformation.
Mit Blick auf die unbegreiflich rasanten Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) wird von einer ‹Transformation der Gesellschaft› gesprochen, die vor der Tür steht. Die Landwirtschaft ist nicht ‹vor› der Transformation, sie steckt seit Jahrzehnten mittendrin. Das, was heute unter Schlagworten wie Strukturwandel, Höfesterben, und Rationalisierung beschrieben wird, hat kaum einen anderen Bereich so früh und so brutal getroffen wie bäuerliche Familien. Für sie heißt ‹Transformation› meist nicht Aufbruch, sondern ein permanenter Überlebenskampf im Sog von Preis- und Wettbewerbsdruck, Flächenkonzentration und technischer Aufrüstung. Sie haben erlebt, wie immer größere Maschinen immer mehr Menschen ersetzen, wie politische Rahmenbedingungen sie von Förderperiode zu Förderperiode treiben, wie bäuerliches Wissen durch standardisierte Verfahren ersetzt wird. Was der restlichen Gesellschaft mit der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz jetzt erst dämmert – dass ganze Tätigkeitsfelder und Lebensentwürfe ins Rutschen geraten –, erleben Bäuerinnen und Bauern seit Langem: die Erfahrung, austauschbar zu sein.
Ich selbst bin nicht auf einem Hof aufgewachsen. Ich bin erst Anfang 20 über ein Praktikum in die Landwirtschaft hineingestolpert, habe mich dann in der Mitte meiner Zwanziger bewusst für eine landwirtschaftliche Ausbildung entschieden, mit der naiven Vorstellung: Beim Höfesterben werden doch Höfe frei, irgendjemand muss die doch übernehmen. Da muss es doch möglich sein, als engagierter, ausgebildeter Junglandwirt einen Betrieb zu finden. Die Realität hat mich ziemlich schnell eingeholt. Wenn man den Hof nicht erbt oder nicht zufällig Zugang zu ein paar Millionen Euro hat, ist eine Hofübernahme in Deutschland heute kaum möglich. Boden ist zum Spekulationsobjekt außerlandwirtschaftlicher Investoren geworden, und wer als Quereinsteiger zur Landwirtschaft kommt, steht vor einer Wand aus Eigentumsverhältnissen und Renditelogik.
Richtig verstanden habe ich dieses System erst, als ich auf dem Luzernenhof bei Freiburg gelandet bin – einem gemeinschaftsgetragenen Betrieb mit gemeinschaftlichen Eigentumsverhältnissen. Bis dahin war ich, wirtschaftswissenschaftlich sozialisiert, eher im neoliberalen Denken unterwegs. Auf dem Luzernenhof durfte ich lebendige Commons erleben. Ich habe erlebt, was passiert, wenn eine Gemeinschaft Verantwortung übernimmt und einen Hof gemeinschaftlich trägt. Wir haben damals eine Kampagne gestartet und rund eine Million Euro von etwa 200 Menschen eingesammelt, um den Hof in Gemeinschaftshand zu bringen.
Diese Erfahrung hat mich geprägt und schließlich zur Kulturland-Genossenschaft geführt, wo ich acht Jahre lang daran gearbeitet habe, Höfe aus der Bodenverwertungslogik herauszuholen und außerfamiliäre Hofnachfolgen zu ermöglichen. Mehr und mehr wurde mir klar: Die Krise der Landwirtschaft ist kein isoliertes Randphänomen einer ‹Problembranche›. Sie ist ein Brennglas für eine viel größere gesellschaftliche Umwälzung, die gerade erst richtig Fahrt aufnimmt – und deren sichtbarster Beschleuniger im Moment die künstliche Intelligenz ist.
In meinem Alltag sind Anwendungen künstlicher Intelligenz längst allgegenwärtig. Ich erlebe gerade, wie sich ganze Arbeitsfelder in neuester Zeit radikal verändern. In der Landwirtschaft ist das erst die Vorhut: autonome Traktoren, Robotik, Drohnen, datengetriebene Bewirtschaftung. So halte ich es auch für wahrscheinlich, dass wir in zwei Generationen eine Landwirtschaft sehen werden, die zu 90 oder 95 Prozent ohne Menschen auf dem Feld auskommt.
Das kann man faszinierend finden, erschreckend oder beides. Für mich ist entscheidend: KI ist eine zivilisatorische Zäsur. Sie greift nicht nur in Produktionsprozesse ein, sondern in unsere innersten Beziehungsräume. Es gibt heute Jugendliche, die eine KI-Persona als ‹engen Freund› bezeichnen. Gemäß einer aktuellen Umfrage gaben 52 Prozent der 13- bis 17-Jährigen in den USA an, einen ‹AI companion› zu haben, mit dem sie regelmäßig interagieren und emotionale Beziehungen haben. Wir wissen aus der Psychologie, wie leicht wir dazu neigen, Sprache mit Bewusstsein zu verwechseln. Und jetzt stellen wir uns ein System vor, das perfektes, empathisches, immer verfügbares ‹Gegenüber› simulieren kann, ohne eigene Verletzlichkeit, ohne eigene Begrenztheit, ohne leibliche Präsenz. Ich glaube nicht, dass wir als Menschen evolutionär dafür gerüstet sind, diese Art von ‹Beziehung› mental sauber getrennt zu halten. Und schon gar nicht 13- bis 17-jährige Jugendliche.
Emotionales Wachstum
Wenn Landwirtschaft also seit Jahrzehnten durch Mechanisierung, Marktlogik und Digitalisierung transformiert wird und KI gleichzeitig unsere Art, zu arbeiten, zu kommunizieren und gar Freundschaft zu erleben, durcheinanderwirbelt, reicht es aus meiner Sicht nicht, noch eine Förderrichtlinie zu justieren oder die nächste ‹Zukunftskommission› zu berufen. Die Antwort, die der einzelne Mensch auf diese Umwälzungen geben kann, liegt woanders. Sie liegt im Inneren.
Ich bin in den letzten Jahren immer wieder bei Erich Fromm gelandet – ‹Die Kunst des Liebens› oder ‹Furcht vor der Freiheit›. Fromm beschreibt, wie sehr moderne Gesellschaften dazu neigen, Menschen in funktionale Rollen zu pressen, sie innerlich leer zu machen und dann diese Leere mit Konsum, Arbeit und Unterhaltung zuzukleistern. Gleichzeitig leben wir in Mitteleuropa auf einem Boden, der von transgenerationalem Trauma durchzogen ist. Das ist kein historischer Fußnotenkommentar, das lebt weiter in nahezu allen Familien – in der Art, wie wir Nähe und Distanz regeln, wie wir mit Angst, Konflikt und Macht umgehen.
Wenn ich von ‹innerer Transformation› spreche, meine ich nicht ein bisschen Achtsamkeits-App oder Resilienzcoaching, damit wir den Status quo besser aushalten. Ich meine eine tatsächlich tiefgreifende Bewegung: dass wir beginnen, dieses vererbte Trauma wahrzunehmen, zu benennen, zu betrauern. Dass wir uns üben in Formen von Beziehung, die nicht auf Macht, Abwertung und Anpassung beruhen, sondern auf Würde, Freiheit und Verbundenheit. Marshall Rosenbergs Gewaltfreie Kommunikation ist für mich in diesem Kontext kein nettes Kommunikationstool, sondern eine radikale Praxis: Sie lädt uns ein, aus dem alten Muster von Schuld, Angriff und Rechtfertigung auszusteigen und unsere Bedürftigkeit und Verletzlichkeit ehrlich anzuschauen – bei uns und bei den anderen.
Rudolf Steiner hat immer wieder betont, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zum Gegenstand der Beobachtung und Entwicklung zu machen – dass wir nicht nur Produkte unserer Biografie und unserer Triebe sind, sondern Gestalterinnen und Gestalter unseres inneren Weges. In der biodynamischen Landwirtschaft ist diese Sicht auf den Menschen eng mit der Arbeit am Hof verknüpft: Landwirtschaft nicht nur als Technik, sondern als Übungsfeld, in dem der Mensch sich in Beziehung zur lebendigen Welt bildet – in Achtsamkeit, Verantwortlichkeit und im Bewusstsein, Teil größerer Zusammenhänge zu sein.
In einer Welt, in der Maschinen immer mehr Denk- und Routinearbeit übernehmen, wird es aus meiner Sicht zu einer Überlebensfrage, ob wir als Menschen emotional erwachsen werden. Ob wir lernen, liebevoll mit uns selbst umzugehen, uns nicht permanent zu überfordern, nicht in zynische Distanz zu flüchten. Ob wir es schaffen, in Dankbarkeit und Demut zu leben – dankbar für das, was uns trägt, demütig vor dem, was wir nicht kontrollieren. Beides ist das Gegenteil der Haltung, die unsere gegenwärtigen Systeme prämiieren: Optimierung, Wachstum, ständige Selbststeigerung.
Der geschlossene Kreis
Und genau hier schließt sich für mich der Kreis zurück zur Landwirtschaft. Wenn KI große Teile der technischen und organisatorischen Arbeit in der Landwirtschaft übernehmen wird, dann geht es bei den verbleibenden Inseln nicht mehr primär um Produktivität, sondern um Menschlichkeit. Um die Frage: Wo in dieser hochautomatisierten Welt bleiben die Orte, an denen Menschen real, mit Körper, Händen und Sinnen in Beziehung zu Erde, Pflanzen, Tieren und anderen Menschen treten können?
Ich glaube, dass Orte, an denen Landwirtschaft betrieben wird, im besten Sinne zu Refugien für die Menschheit werden können. Orte, an denen nicht Algorithmen die zentrale Rolle spielen, sondern Menschen – mit ihren Geschichten und ihrer Sehnsucht nach Sinn und Zugehörigkeit. Höfe, auf denen Kinder noch erleben, wie ein Kalb geboren wird, wie Regen riecht, wie Erde sich nach einem trockenen Sommer anfühlt. Höfe, auf denen Wohnen, Arbeiten, Lernen und soziale Beziehungen nicht auseinanderfallen, sondern ineinandergreifen.
Damit das Realität wird, reicht es nicht, ‹Bio› aufs Schild zu schreiben und ein paar Blühstreifen anzulegen. Es braucht gemeinschaftsgetragene Höfe, die ihre inneren Verhältnisse ernst nehmen: Wie gehen wir miteinander um? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie verteilen wir Geld, Verantwortung und Risiko? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie mit Macht? Wenn wir Höfe als Refugien denken, dann sind sie nicht nur Orte klimafreundlicher Produktion, sondern Schulen für eine andere Art, Mensch zu sein.
Ich glaube nicht, dass wir die KI-Entwicklung stoppen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir die Strukturkrise in der Landwirtschaft allein über politische Maßnahmen auflösen können. Aber ich glaube, dass wir entscheiden können, wie wir diesen Prozessen innerlich begegnen – und welche Orte wir bauen, in denen Menschen auch in 20 oder 50 Jahren noch spüren können, was es heißt, lebendig zu sein. Für mich heißt das ganz konkret: innere Transformation ernst nehmen, Traumaheilung nicht als Nischenarbeit sehen, Liebe und Dankbarkeit nicht als Gefühlsduselei abtun, sondern als Fähigkeiten, die wir kultivieren müssen.
Und es heißt, Landwirtschaft nicht nur als Beruf, sondern als verantwortliche Praxis zu begreifen: eine Landwirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Höfe zu Refugien macht – für uns, für unsere Kinder, für eine Gesellschaft, die Gefahr läuft, den Kontakt zu sich selbst zu verlieren.
Bild Schafe auf dem Goetheanum Campus, Foto: François Croissant